Um den Koptischen Text in Anmerkung 31 richtig darzustellen ist die Unicode-Schrift Titus erforderlich.
Vom Sinn ostkirchengeschichtlicher Forschung an einer Evangelisch-Theologischen Fakultät – Gedanken zum 40jährigen Bestehen des Seminars für Ostkirchengeschichte in Marburg
von
Karl Pinggéra
Wenn ihr vom Osten redet, müßt Ihr, Ihr könnt nicht anders, vom Lichte des Ostens reden, beglückt durch seine Wunder, dankbar für seine Gaben!” Die Wiege des Theologen, der mit diesen Worten eines seiner bedeutendsten Werke einleitete, stand an der Lahn. Von 1892 bis 1895 lehrte er als Repetent und Privatdozent an Marburgs Alma Mater Philippina. Die Rede ist von Adolf Deissmann (1866-1937) und seiner Studie über “Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt”, der er den Titel gegeben hat: “Licht vom Osten”1.
Unsere Überlegungen zum 40jährigen Bestehen des Marburger Seminars für Ostkirchengeschichte können an den Ex-Marburger2 Deissmann nicht nur aufgrund eines Buchtitels anknüpfen. Denn Adolf Deissmann zählte in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg zu den treibenden Kräften, die die deutschen evangelischen Kirchen zur Teilnahme an der noch jungen ökumenischen Bewegung auf Weltebene drängten.3 Er besuchte nicht nur die Weltkirchenkonferenz für Praktisches Christentum in Stockholm 1925 und die Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung in Lausanne 1927, sondern war seit 1929 auch Mitglied des ökumenischen Rates für Praktisches Christentum. Von Anfang an hatte Deissmann in sein ökumenisches Engagement die Kirchen des Ostens miteinbezogen. Aus seinen Veröffentlichungen zur Frage der Kircheneinheit, aber auch aus seinen neutestamentlichen Forschungen tritt uns die Sympathie entgegen, mit denen der deutsche Gelehrte den alten orthodoxen Kirchen begegnete. Seine langjährigen Forschungsreisen nach Palästina und Kleinasien, wo er unter anderem an den Ausgrabungen des Österreichischen Archäologischen Instituts in Ephesus teilnahm, hatten ihn mit wichtigen Vertretern der östlichen Patriarchate in Verbindung gebracht. Aus eigener Anschauung und durch persönliche Kontakte hatte sich Deissmann eine Meinung über diese Kirchen gebildet, die sich von den vernichtenden Urteilen seines Berliner Fakultätskollegen Adolf von Harnack grundlegend unterschied.4 Nicht nur, daß Deissmann in seinen neutestamentlichen Arbeiten immer wieder auf die engen Traditionen hinwies, die die orthodoxe Kirche mit der christlichen Urzeit verbinden. Er war auch zu der Überzeugung gelangt, daß diese Überlieferung unter den Orthodoxen lebendige Wirklichkeit sei, an der der Westen nur zu seinem eigenen Schaden vorübergehen könnte.
Zur Stockholmer Konferenz führte er aus: “Die Teilnahme der Orientalen war besonders erfreulich. Die Ostkirchen gaben nicht nur eine eigenartige Note in der Gesamterscheinung der Konferenz, sondern offenbarten auch die wertvollen religiösen Kräfte, die durch die orthodoxe Christenheit aus der christlichen Urzeit gerettet sind. Der Westen kann hier viel von dem Osten lernen.”5 Es liegen Welten zwischen dieser Aussage und Harnacks im deutschen Protestantismus so wirksam gewordener Qualifizierung der Ostkirchen als letztlich “unterchristlichen” Gebilden, die aus dem Geist des spätantiken Synkretismus hervorgegangen seien und die “in kultureller, philosophischer und religiöser Hinsicht das versteinerte 3. Jahrhundert” repräsentierten.6
Zu einer positiveren Neubewertung der Ostkirchen war es freilich schon durch Karl Holl gekommen, der sich in seinem 1913 erschienenen Aufsatz über “Die religiösen Grundlagen der russischen Kultur”7 darum bemüht hatte, die Harnackschen Vorurteile abzubauen. Aber doch rückten die Kirchen des Ostens erst im Zeichen der ökumenischen Bewegung neu in das Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit – einer Bewegung, die nicht zuletzt durch die Enzyklika des Ökumenischen Patriarchates von Konstantinopel “An die Kirchen Christi überall”8 vom Jahre 1920 initiiert worden war.
In diesem Rahmen ist die Widmung zu sehen, die Adolf Deissmann seinem Bericht über die Stockholmer Konferenz vorangestellt hat: “Dem frommen und dankbaren Gedächtnis des seligen Patriarchen von Alexandria, Photios, des Erben heiliger Urüberlieferung der Kirche Jesu Christi durch zwei Jahrtausende, des ehrfurchtgebietenden greisen Bekenners, der Stockholm mit Nicäa verband und nach gesegnetem ökumenischen Tagewerk heimgehend am 5. September 1925 in Zwinglis Stadt begnadet ward, uns in die Ewigkeit voranzuschreiten.”9 Für Besucher wie Deissmann muß es zu den bewegendsten Augenblicken der Weltkirchenkonferenz gehört haben, als der griechisch-orthodoxe Patriarch Photios im Abschlußgottesdienst, einer lutherischen “Högmässa” im Dom zu Uppsala, das nizänokonstantinopolitanische Glaubensbekenntnis im griechischen Original verlas. Darauf die spielt Widmung des Buches an – und auf den Tod des Patriarchen, der ihn während seiner Heimreise in Zürich (“Zwinglis Stadt”) ereilte.
Die Anfänge der ökumenischen Bewegung in Deutschland, die wir uns am Beispiel Deissmanns vergegenwärtigt haben, halfen nicht zuletzt den Boden zu bereiten für die Verankerung ostkirchengeschichtlicher Forschung an Evangelisch-Theologischen Fakultäten. Denn als nach dem Zweiten Weltkrieg die Ökumene durch die Gründung des Weltkirchenrates auf eine neue Basis gestellt war und als sich gerade in Deutschland der Blick in ganz neuer Weise nach Osten richtete, kam es zur Einrichtung von Lehrstühlen, die teils der Konfessionskunde unter Einschluß der östlichen Kirchen, teils speziell der Erforschung des Christlichen Ostens dienen sollten. Neben Erlangen, Heidelberg, Münster, Berlin und Halle war dies in Marburg 1961 der Fall. Dem waren langjährige Bemühungen der Arbeitsgemeinschaft für Oststudien an den hessischen Universitäten Frankfurt, Gießen und Marburg vorangegangen, ein Kreis, zu dessen Mitgliedern neben Ernst Benz (1907-1978) auch Hildegard Schaeder (1902-1984)10 gehörte.
In Marburg stellte die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Christlichen Osten kein novum dar. Hier lehrten mit Friedrich Heiler (1892-1967) und dem eben genannten Ernst Benz ein Religionswissenschaftler und ein Kirchenhistoriker, denen (neben mancherlei Differenzen) das Interesse an Geschichte und Gegenwart der Ostkirchen gemeinsam war. Von Nathan Söderblom nach Stockholm und Lausanne eingeladen, hatte Heiler übrigens (ähnlich wie Deissmann) die deutsche Öffentlichkeit in mehreren Aufsätzen vom Verlauf der beiden Konferenzen in Kenntnis gesetzt.11 Darin konnte er mit bewegenden Worten auch von einer persönlichen Begegnung mit Patriarch Photios von Alexandrien berichten.12
Der Ruf für den neuen Lehrstuhl erging an den Münsteraner Privatdozenten Peter Kawerau (1915-1988)13. Der 1915 geborene Kawerau, der aus einer alten protestantischen Gelehrtenfamilie stammte14, hatte bei Bertold Spuler eine philosophische Dissertation über die Geschichte der syrisch-orthodoxen Kirche vom 11. bis zum 13. Jahrhundert angefertigt15, ehe er bei Robert Stupperich in Münster mit einer Arbeit über den radikalen Täufer Melchior Hofmann den theologischen Doktorgrad erwarb16. Als Habilitationsschrift verfaßte er 1958 ebenda die bis heute unentbehrliche, an Materialfülle und Gründlichkeit unerreichte Studie über “Amerika und die Orientalischen Kirchen”, in der die Anfänge der amerikanischen Mission im Vorderen Orient untersucht werden17. Von seinem wissenschaftlichen Werdegang her war Kawerau in der Lage, den Horizont des eben aus der Taufe gehobenen Lehrstuhls über das geplante Maß hinaus zu erweitern. Denn von Anfang an beschränkte sich Kawerau weder in der Forschung noch in der Lehre auf die Kirchen des griechisch-slavischen Raumes. Durch seine Ausbildung bei Bertold Spuler, einem der wenigen Orientalisten, die sich schwerpunktmäßig mit dem Christlichen Orient beschäftigten18, war Kawerau befähigt, auch die Christentumsgeschichte des Orients von den Quellen her zu erschließen. Damit erhielt das Marbuger “Seminar für Ostkirchengeschichte” eine Prägung, die es von entsprechenden Einrichtungen an anderen Fakultäten unterscheidet.19
Es würde den vorliegenden Rahmen sprengen, sollten darin die Leistungen der mit der Ostkirchengeschichte befaßten Marburger Gelehrten en detail gewürdigt werden. Zu ihnen sind natürlich auch Peter Kaweraus Nachfolger, Professor Wolfgang Hage, wie auch Honorarprofessor Georg Günter Blum, der ehemalige Marburger Privatdozent Martin Tamcke (jetzt Professor in Göttingen) und andere mehr hinzuzufügen.20 Vielmehr soll – in durchaus programmatischer Absicht – der Frage nachgegangen werden, welchen Sinn die ostkirchengeschichtliche Forschung an einer Evangelisch-Theologischen Fakultät besitzt und in Zukunft besitzen wird. Mögliche Antworten auf diese Frage werden also im Blick auf die Gegenwartsbedeutung des Faches formuliert werden; doch soll dies nicht ohne Rückgriff auf die Einsichten der eben genannten Wissenschaftler geschehen. Weit entfernt vom Anspruch auf Vollständigkeit, lassen sich unsere Überlegungen in vier Punkten thesenartig zusammenfassen:
1. Ostkirchengeschichte verhilft der Theologie zu einer notwendigen Erweiterung ihres Horizontes.
Zu den vornehmlichen Zielen, die Peter Kawerau wie auch sein Nachfolger in Lehre und Forschung verfolgten und verfolgen, gehört die Überwindung eines einseitig auf Europa fixierten Bildes des Christentums.21 Es ist ja doch so, daß sich der Blickwinkel der herkömmlichen Gesamtdarstellungen des Christentums von Epoche zu Epoche zunehmend verengt. Ist in der Alten Kirche noch die ganze Oikumene wenigstens im Sinne der Christenheit innerhalb der römischen Reichsgrenzen präsent, so liegt der Schwerpunkt im Mittelalter schon eindeutig im Abendland, um sich in der Reformationsgeschichte auf Deutschland und, je mehr wir uns der Gegenwart nähern, dann auf die Geschichte der eigenen Landeskirche einzuschränken.
Kawerau setzte dagegen eine eigene Konzeption der Kirchengeschichte, die den Stoff in einer, wie er es nannte, “vertikalen” Aufgliederung darbot.22 Damit sollten die Zusammenhänge zwischen den geographisch voneinander getrennten und den daher zeitlich sehr unterschiedlich christianisierten Kulturräumen verdeutlicht werden. So behandelte er in seinen Vorlesungen zur Ostkirchengeschichte 1. Asien und Afrika, 2. Byzanz, 3. das Zeitalter der Kreuzzüge und 4. die Geschichte Südost- und Osteuropas.23 Für Kawerau erwies sich in diesem Konzept geradezu die Modernität seines Faches. Denn das Zusammenwachsen der einen Welt, der stetig zunehmende Austausch zwischen Völkern und Kulturen erfordere “auch vom modernen Theologen ein modernes” – und das hieß für Kawerau – “ein universales Geschichtsbild”. Ostkirchengeschichte, ein Fach, das sich von der Christianisierung Edessas um das Jahr 100 bis zur Missionsbewegung der ostsyrischen Kirche erstreckt (welche bereits um 600 China erreichte), das das Schicksal der äthiopischen Kirche ebenso behandelt wie die Geschichte der Balkanvölker, das dem Verhältnis von Kirche und Staat in Rußland gleichermaßen nachgeht wie dem Überlebenskampf der armenischen Christenheit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dieses Fach also sei, so Kawerau, “nicht Ausdruck eines abseitigen, weltfremden Spezialistentums, sondern Ausdruck des Fortschritts der theologischen Wissenschaft auf dem Gebiet der Kirchengeschichte. Wer von ihr keine Notiz nimmt, muß sich darüber im klaren sein, daß er ein objektiv falsches, den modernen Anforderungen nicht genügendes Geschichtsbild mit sich durchs Leben trägt, das moderne wissenschaftliche Erkenntnisse einfach ignoriert.”24
Daran ist doch sicher soviel richtig, daß die Ostkirchengeschichte ein notwendiges Korrektiv zur Allgemeinen Kirchengeschichte bildet, die naturgemäß das eigene historische Herkommen in den Vordergrund rückt. Der Blick auf den christlichen Osten schärft, wie Wolfgang Hage es einmal formuliert hat, das Bewußtsein dafür, daß das Christentum schlechthin nicht identisch sei mit jenem Christentum, wie wir es aus unserer eigenen abendländischen Tradition kennen – eine Meinung, die so wohl kaum ernsthaft vertreten werde, die sich aber doch immer wieder durch den Hintereingang des theologischen Normalbewußtseins einschleiche.25
Zu den interessantesten Facetten der Ostkirchengeschichte gehört mit Sicherheit, Inkulturationsprozesse des Christentums zu verfolgen, die unabhängig von der abendländischen Missionstätigkeit verlaufen sind. Der Besucher eines koptischen Gottesdienstes hört noch heute Melodien, deren Ursprünge im pharaonischen Tempelkult liegen. Der liturgische Tanz in der äthiopischen Kirche speist sich aus Quellen afrikanischer Religiosität. Die griechisch-orthodoxen Christen der Levante haben die literarische und wissenschaftliche Renaissance der arabischen Welt im 19. und 20. Jahrhundert in entscheidender Weise mitgeprägt; sie verstehen sich als integraler Bestandteil der arabischen Kulturwelt.
Es ist nicht zu bestreiten, daß durch Beobachtungen wie diese das Christentum, das wir doch zu kennen meinen, für uns in einem ungewohnten Licht erscheint. Daß im “Licht vom Osten” aber nicht nur (etwa) liturgische Eigenheiten anderer Kirchen zu Tage treten (Ostkirchengeschichte ist mehr als ein ethnologisches Kuriositätenkabinett!), sondern daß in diesem Lichte Grundgegebenheiten unseres eigenen Christentums mit einem Mal viel von ihrer vermeintlichen Selbstverständlichkeit verlieren, kann man sich an folgendem Beispiel vor Augen führen: Wenn wir uns mit der ostsyrischen Christenheit beschäftigen, begegnen wir einer Kirche, für die es in ihrer langen Geschichte niemals so etwas wie ein “Konstantinisches Zeitalter” gegeben hat.26 Die Christenheit östlich der römischen, sodann der byzantinischen Reichsgrenze lebte stets unter nichtchristlichen, manchmal auch antichristlichen Herrschern. Ist es nicht von höchstem Interesse, das Lebens- und Glaubenszeugnis dieser Kirche zu erforschen, nachdem auch in unserem Land das Konstantinische Zeitalter unwiderruflich zu Ende geht? Und ist es nicht von höchstem Interesse, nach den Gründen dafür zu fragen, wie diese einst größte Missionskirche in der Christentumsgeschichte27, deren Bistümer vom Mittelmeer bis zum Pazifik reichten, durch die Ungunst der politischen Umstände ab dem 14. Jahrhundert auf wenige hunderttausend Mitglieder zusammenschmelzen konnte, die heute über den ganzen Globus zerstreut leben28?
Die Entdeckung, daß jenseits der abendländischen Christenheit Kirchen mit reicher Tradition und Geschichte beheimatet sind, ist natürlich nicht neu. Aber es ist notwendig, daß sie immer wieder aufs neue gemacht wird. Es ist nur zu hoffen, daß diese Entdeckung dann mit einer solchen Freude Hand in Hand geht, wie sie aus jenem Dokument spricht, das man als die “Geburtsstunde der öffentlichen Aufmerksamkeit in Deutschland für die östlich-orthodoxe Kirche”29 bezeichnet hat. Gemeint ist hier die “Rede über den heutigen Stand der Kirche in Griechenland, Kleinasien, Afrika, Ungarn und Böhmen etc.”, mit der der lutherische Theologe David Chytraeus am 18. Oktober des Jahres 1569 nach längerer Abwesenheit seine Vorlesungen an der Universität Rostock wiederaufnahm. Chytraeus (1531-1600), einer der führenden Theologen der Konkordienformel, war auf Einladung Kaiser Maximilians II. und der österreichischen Stände 1568 über Prag nach Österreich gereist, um dort eine lutherische Kirchenordnung und eine Agende auszuarbeiten. Aufgrund verschiedener Widrigkeiten sah er sich nach seiner Ankunft jedoch bald zur Tatenlosigkeit verurteilt. So nutzte er die Zeit, um Studienreisen zu unternehmen, die ihn bis zur äußersten Grenze der habsburgischen Lande führten. Dort wurde seine Aufmerksamkeit auf die orthodoxe Christenheit gelenkt. Mit zwei Griechen, darunter ein orthodoxer Bischof, kam es zu einem intensiveren Austausch. Die oben erwähnte Rede ist als Frucht dieser Begegnungen anzusprechen. Es sollen hier nur wenige Zeilen aus der Einleitung zitiert werden, die – wenigstens im Ansatz – an das Anliegen erinnern, den Eurozentrismus im Blick auf das Christentum zu überwinden. Angesichts der Türkengefahr wie auch des konfessionellen Haders sei es für Chytraeus “ein außerordentlich tiefer und süßer Trost” gewesen, “daß ich … habe erfahren dürfen, daß die den wahren Gott, den ewigen Vater, Sohn und heiligen Geist anerkennende und verehrende Kirche Christi auf der Welt nicht nur an allen Orten und zu allen Zeiten und auchnicht nur in diesem so kleinen und nur so engen Gebiete Europas ihren Bestand hat, sondern, daß sie auch inmitten der Türkei, in Griechenland, Kleinasien, Armenien, Georgien und den weiten Reichen des inneren Afrika durch öffentliche Ausübung des Dienstes am Evangelium Christi und den Sakramenten zusammengehalten und am Leben erhalten wird.”30
Die Horizonterweiterung, zu der die Ostkirchengeschichte im Rahmen einer theologischen Fakultät ihren Beitrag leisten kann, hat auch ihre praktischen Seiten, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. Die Marburger Fachvertreter haben stets großen Wert gelegt auf das Erlernen der Quellensprachen als des Handwerkszeuges, ohne das ein vertieftes Studium des Christlichen Ostens nicht möglich ist. Auch wenn Lehrveranstaltungen, die etwa in das Syrische, Äthiopische, Koptische, Georgische, Armenische oder das Arabische einführen, sich naturgemäß immer nur an einen kleinen Kreis von Interessierten richten werden, kommen sie doch nicht zuletzt den anderen historischen Disziplinen der Theologie, der Patristik und den exegetischen Fächern, zugute. Es ist nicht das Schlechteste, was man von einer wissenschaftlichen Disziplin sagen kann, wenn man sie (auch!) als “Dienstleistungsdisziplin” für benachbarte Fächer bezeichnet.31
2.Ostkirchengeschichte vermittelt diejenigen Kenntnisse, die einefruchtbare Begegnung mit den Christen des Ostens erst ermöglichen.
Einen der Gründe, der das Interesse an den Kirchen des Ostens förderte, wird man mit Sicherheit in der Tatsache erblicken dürfen, daß es im 20. Jahrhundert vermehrt zu direkten Kontakten mit Christen aus dem Osten gekommen ist. Die Welt der Orthodoxie tauchte vor der eigenen Haustüre auf und war nicht länger bloßer Gegenstand konfessionskundlicher Handbücher. In Marburg ist es noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zu einer solchen unmittelbaren Begegnung gekommen. Friedrich Heiler hatte bemerkt, daß es viele Zwangsarbeiter und ehemalige Kriegsgefangene aus Rußland nach Marburg und Umgebung verschlagen hatte. Unter ihnen befanden sich zahlreiche getaufte orthodoxe Christen und auch einige Geistliche, mit denen Heiler Verbindung aufgenommen hatte. Ihnen ermöglichte er es, am Sonntag Rogate, dem 6. Mai des Jahres 1945, in der Elisabethkirche einen, wenngleich etwas verspäteten, Ostergottesdienst zu halten.32 Heiler leitete diesen Gottesdienst in hochkirchlich liturgischem Gewand zusammen mit den orthodoxen Priestern und Diakonen. Das Kirchenslavische und das Russische waren dem Marburger Theologen bestens vertraut. Im Osternachtsgottesdienst und in der Chrysostomus-Liturgie sei er, so sein Schwiegersohn Hans Hartog, zumindest theoretisch ebenso “zu Hause” gewesen wie seine orthodoxen Amtsbrüder. Am Sonntag Exaudi, dem 13. Mai, dem ersten Sonntag nach Inkrafttreten des Waffenstillstandes, ist Heiler auf dieses Ereignis selbst in seiner Predigt in der Elisabethkirche zu sprechen gekommen: “Dieses Gotteshaus öffnete sich kürzlich den orthodoxen Brüdern vom Balkan und von Rußland. Es war ergreifend, heute vor acht Tagen in dieser Kirche viele russische Männer, Frauen und Kinder zu sehen, von denen manche Tränen der Freude vergossen. Jahrelang hatten sie keine Möglichkeit, den heimischen Gottesdienst zu feiern. Nun aber konnten sie hier wieder die alten Ostergesänge in ihrer Kirchensprache hören, die heiligen Bilder küssen und zum Tisch des Herrn gehen.”33
Nachdem Deutschland in den letzten Jahrzehnten für so viele Christen aus dem Osten zur neuen Heimat geworden ist, und nachdem so viele evangelische und katholische Gemeinden ihre Kirchenräume bereitwillig den neu entstandenen ostkirchlichen Gemeinden geöffnet haben, können wir es uns wohl kaum mehr bewußt machen, welch außergewöhnliches Ereignis diese orthodoxe Osternachtsfeier in einer evangelischen Kirche damals gewesen sein muß. Wenn die Gastfreundschaft, die die Ostkirchen in vielen unserer Gemeinden genießen, mittlerweile zu den Selbstverständlichkeiten im ökumenischen Miteinander gehört, ist dies nicht vorstellbar ohne Pioniere wie Friedrich Heiler. Erst die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Kirchen des Ostens versetzte ihn in die Lage, neben den materiellen auch die geistlichen Bedürfnisse der orthodoxen Christen wahrzunehmen. Echte geschwisterliche Begegnung setzt wenigstens ein Mindestmaß an Kenntnissen über die je andere Kirche voraus. Der Vermittlung dieser Kenntnisse dient das Fach Ostkirchengeschichte, dem damit auch eine eminent kirchenpraktische Bedeutung zukommt.
Die verschiedenen Kirchen sind sich in der Gegenwart so nahe gekommen, daß Ernst Benz schon 1950 schreiben konnte, konfessionskundliches Wissen sei “innerhalb der heutigen weltkirchlichen Situation keine wissenschaftliche Liebhaberei mehr.”34 Um wieviel mehr darf heute gelten, was Benz dazu vor einem halben Jahrhundert notiert hat: “Es kann heute jedem Pfarrer [wir ergänzen in der Zwischenzeit: auch jeder Pfarrerin] stündlich passieren, daß ihn [sie] ein Gemeindemitglied … um eine verbindliche Auskunft über die Anglikanische Kirche, das amerikanische Luthertum, die Ostkirche, die Methodistische Kirche usw. bittet.”35 Benz verfaßte diese Zeilen in einem Beitrag für einen Sammelband über “Orthodoxie und Evangelisches Christentum”, herausgegeben vom Kirchlichen Außenamt der EKD. Dem Generalthema des Bandes entsprechend konzentrierte Benz seine allgemeinen Überlegungen zur Konfessionskunde auf die Begegnung der evangelischen Kirche mit den östlich-orthodoxen Kirchen. Wichtig ist, daß Benz der Frage, welche Bedeutung diese Begegnung für den Protestantismus habe, die korrelative Frage zur Seite stellte: “Welche Bedeutung hat die ökumenische Begegnung mit dem Protestantismus für die östlich-orthodoxe Kirche?” Freilich bilde ein solcher wechselseitiger Austausch schon “das fortgeschrittene Stadium der Arbeit, der die Ökumenik als Wissenschaft zu dienen” habe. Offensichtlich war Benz nicht der Meinung, daß dieses Stadium im ökumenischen Dialog schon erreicht sei, wenn er daran anschließend fordert, zunächst einmal sei die entsprechende “Vorarbeit in jeder einzelnen Konfession selbst zu leisten”36. Als Maxime des Dialoges, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren hat, nennt Benz jedenfalls “die Bereitschaft, von andern her … Fragen an sich selbst zu stellen und stellen zu lassen und sie zum Anlaß einer verantwortlichen Selbstprüfung zu nehmen.” Es sollten gleichwohl nicht alle nur denkbaren dogmatischen Fragen abgehandelt werden im Stil der konfessionellen Apologetik des 16. Jahrhunderts, sondern vielmehr “eine Ökonomie der Liebe” walten, mit der nur die jeweils wichtigsten Fragen auszuwählen seien, “diejenigen, die durch die besonderen Nöte des Zusammenlebens und der Weggemeinschaft gestellt sind”37.
Unter Beteiligung des ostkirchengeschichtlichen Seminars ist es in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zu einer Kooperation mit dem rum-orthodoxen Patriarchat von Antiochien gekommen, die mit dem ökumenisch anspruchsvollen Titel einer “Kirchenfreundschaft” charakterisiert wird.38 Das Ziel dieser Partnerschaft liegt ganz auf der Linie dessen, was Benz einst gefordert hatte, nämlich in einer Weggemeinschaft, in der diejenigen Fragen und Probleme im Mittelpunkt stehen, die im Leben der Kirchen tatsächlich eine Rolle spielen. Es bedarf keiner eigenen Begründung, daß eine solche Freundschaft nur dann von Bestand sein wird, wenn auch das geschichtlich gewordene So-Sein der je anderen Kirche in den Blick genommen wird. Dem Fach Ostkirchengeschichte kommt dabei die Aufgabe zu, hier und auf anderen Ebenen Theologinnen und Theologen zu einer qualifizierten Teilnahme an solchen Dialogen anzuleiten. Es darf ja nicht übersehen werden, daß die Begegnung mit den östlichen Kirchen nicht in erster Linie aus Kontakten zu den Heimatländern der betreffenden Kirchen besteht. Vielmehr geht es um die Begegnung vor Ort in Deutschland mit der drittstärksten christlichen Konfession, zu der die Ostkirchen in unserem Land schon längst geworden sind.
Zu den “anderen Ebenen” des Dialoges, die ich eben genannt habe, gehört natürlich auch der im engeren, fachspezifischen Sinne theologische Dialog. Im Verlauf solcher Dialoge tritt ganz neu ins Bewußtsein, welch herausragende Rolle die Kirchenväter bei der theologischen Urteilsfindung in den Ostkirchen spielen.39 Ernst Benz leitete aus der Beobachtung dieser Tatsache die Forderung für den Protestantismus ab, er habe sich “einen neuen Zugang zu der altkirchlichen Tradition, zu den Kirchenvätern zu erarbeiten”. Denn Benz konstatiert im Protestantismus folgendes ekklesiologische Defizit: “Kaum ein Angehöriger einer protestantischen Kirche hat heute mehr das Bewußtsein, daß Augustin, Chrysostomos, Basilius usw. die Väter seiner Kirche sind, daß er zur Kirche dieser Väter gehört.”40 So ergäbe sich also gerade vom Fach Ostkirchengeschichte her ein gegenwartsrelevanter Zugang zur Patristik – dies nur einer von vielen Berührungspunkten zwischen den beiden Schwesterdisziplinen.
Um das bisher Entfaltete an einem konkreten Beispiel zu veranschaulichen, soll wenigstens angedeutet werden, daß wir bei der Begegnung mit Christen aus dem Vorderen Orient mit dem bedrängenden Problem der stetigen Auswanderung konfrontiert werden. Es fehlt nicht an Stimmen, die davor warnen, daß die christliche Präsenz im Nahen Osten, der Ursprungsregion des Christentums, in naher Zukunft fast ganz verschwinden könnte. Den vielfältigen Gründen dieser Auswanderungsbewegung kann hier nicht nachgegangen werden. Nur erwähnt werden soll, daß Georges Tamer, als Wissenschaftler am semitistischen Institut in Erlangen tätig und zugleich engagiertes Mitglied der rum-orthodoxen Kirche in Deutschland, dieses Phänomen jüngst in folgenden weiteren Zusammenhang gestellt hat: In der Krise des christlichen Daseins im Orient zeige sich ein Indiz für die umfassendere Identitätskrise der arabischen Gesellschaften. Der lesenswerte Aufsatz, in dem Tamer diesen Gedanken ausführt, ist übrigens mit den Worten “Ex Oriente Lux” überschrieben. Allerdings hat der Verfasser ein – bedrohlich wirkendes – Fragezeichen hinter diesen Titel gesetzt.41
Wie die Antwort auf dieses Fragezeichen ausfällt, wird womöglich auch von der Solidarität der westlichen Kirchen mit den Christen des Orients abhängen.42 Für Marburg läßt sich in diesem Zusammenhang an den systematischen Theologen Martin Rade erinnern, der angesichts der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich das von dem Theologen und Publizisten Paul Rohrbach 1897 gegründete Hilfswerk für die verfolgten Armenier tatkräftig unterstützte.43 Dieses trug die schöne und sinnreiche Bezeichnung “Notwendiges Liebeswerk”. Auch öffnete Rade die führende Zeitschrift des liberalen Protestantismus, die “Christliche Welt”, einer Reihe von Beiträgen, die auf die prekäre Situation der Armenier aufmerksam machen sollten. Wie Hacik Gazer nachgezeichnet hat, trat zur praktischen Hilfe auch die Begegnung auf theologischer Ebene. Die Reformkräfte der armenischen Kirche traten in Verbindung mit der liberalen Theologie des deutschen Protestantismus.44
3. Ostkirchengeschichte erschließt den Reichtum der geistlichen Überlieferung des Christlichen Ostens angesichts der Frömmigkeitskrise der Gegenwart
Im Vorwort seiner breit angelegten Darstellung “Das Christentum des Ostens” bekannte sich Peter Kawerau im Sinne der Historik Droysens zu einem “streng wissenschaftlichen Verständnis des östlichen Christentums”. Das so gewonnene Bild würde in manchem von dem abweichen, “was schwärmerische Verehrer eines als Idealreligion hingestellten mystischen, liturgischen oder johanneischen Ostchristentums erwarten mögen”45. Um so auffälliger ist es, daß das so eingeleitete Buch ausklingt mit einer Besinnung auf den Hesychasmus, der mystische Bewegung der Ostkirche. Im letzten Absatz seines Werkes wirft Kawerau in grundsätzlicher Weise die Frage auf, “was eigentlich Mystik” sei, um mit der Feststellung zu schließen: “Das aber ist im Kern die Frage nach dem Wesen des Menschen und zugleich die Frage nach dem Wesen der Religion, die uns heute in neuer Weise gestellt ist, und zu deren Beantwortung uns das Christentum des Ostens Wege zeigen und geistige Hilfen darbieten kann.”46
Es scheint so, als sei Kawerau gleichsam “wie von selbst” durch den Gegenstand seiner Forschungen zu dieser Frage nach der Mystik geführt worden. Denn niemandem, der sich mit Vergangenheit und Gegenwart der östlichen Christenheit beschäftigt, kann verborgen bleiben, daß das, was wir als Frömmigkeit, Spiritualtät oder geistliches Leben bezeichnen, im Christlichen Osten in ganz anderer Weise das gelebte Christentum bestimmt, als es im Westen der Fall ist.47 Die Fülle von Gebeten und Hymnen, aus denen sich das liturgische Leben der Ostkirchen speist, dient nicht zuletzt als Hilfestellung zu einem innerlichen Christsein. Heiler beschrieb dies mit den Worten, daß sich “in der Kirche des Ostens hinter dem schimmernden Glanz liturgischer Pracht” die kraftvolle und innige Frömmigkeit östlichen Christentums verberge.48 Letztlich sucht die östliche Überlieferung jenseits der Worte und Bilder jenen Ort, an dem der Mensch Gott im Schweigen – gerade auch im Schweigen aller diskursiven Verstandestätigkeit – begegnet.49
Wie ostkirchliche Mystik mit der Metapher des Lichtes über alle Gedanken und Bilder hinausgreift, erfuhr Ernst Benz mit wohl kongenialem Einfühlungsvermögen während seines Besuches auf dem Athos zur Tausendjahrfeier des Heiligen Berges 1963. In seinem Reisebericht schildert er, wie er neben einem Einsiedler auf der Terrasse des Kellions Platz genommen hatte und auf das Meer hinausblickte: “Da stand auf einmal die Zeit still. Es war eigentlich nichts Besonderes, was da geschah, keine Vision oder so etwas Ähnliches, sondern einfach ein Hinauswitschen – ich kann es nicht anders nennen – aus dem Gitter der Sekunden in die Zeitlosigkeit. … das Meer war leer und der Himmel war leer … Und das Meer schimmerte im Licht und der Himmel schimmerte im Licht … Und das glitzernde Licht des Meeres ging ohne Grenzlinie in das glitzernde Licht des Himmels über und es war ein Licht und eine Leere oder eine Fülle, wie man es nennen will, die sich gegen die Sonne hin verdichtete, die nunmehr fast im Zenit stand, und der Strom der Gedanken und der Ablauf der Bilder hörte auf und ich hatte nur die eine Empfindung: wenn das Licht noch um einen einzigen Grad sich verstärkt, dann löst sich alles auch im physischen Sinn vollends in Licht auf und wird selber Licht, der Mönch vor mir, das Meer, der Himmel, das Feld, die Blätter, die Balken, ich selbst, dann wird alles verwandelt in das Licht und geht ein in die Strahlen, die sich um die Quelle des Lichts im Zenit verdichten.” Hier bricht die Erfahrung freilich ab, und Benz bemerkt: “Ebenso unbemerkt, wie ich den Maschen der Zeit entschlüpft war, kehrte ich in ihr Gefängnis zurück.”50
Der Marburger Honorarprofessor Georg Günter Blum ging der Frage nach, ob die mystische Überlieferung des Ostens nicht neu fruchtbar zu machen sei angesichts der Frömmigkeitskrise, in der sich das Christentum des Westens befinde. Das Ungenügen an überkommenen Formen der privaten Andacht lasse sich nicht zuletzt an der breiten Rezeption fernöstlicher Spiritualität ablesen: “Angesichts der Übernahme einer solchen asiatischen Versenkungsübung, die zutiefst einer inneren Notwendigkeit unserer religiösen Situation zu entsprechen scheint, stellt sich mit immer größerer Dringlichkeit die Frage: Warum sind wir auf solche Methoden aus dem fernen Osten angewiesen? Gibt es nicht auch eine legitime christliche Praxis der Meditation, nicht nur bestimmter Inhalte des biblischen Wortes und der Symbole des Glaubens, sondern vielmehr auch der un- und übergegenständlichen Betrachtung, der Kontemplation als eines Sich-Einlassens in den absoluten Wesensgrund unserer Existenz? Und damit ist sofort die andere Frage verbunden: Wie wird eine solche Möglichkeit christlicher Frömmigkeitspraxis als Glaubensvollzug theoretisch interpretiert und theologisch verantwortet? Diese Fragen stellen sich nicht nur der Exegese und Dogmatik, sondern auch der historischen Theologie, handelt es sich doch hier um einen wichtigen Aspekt der Geschichte des Glaubens, wie sie sich in den christlichen Konfessionen in unterschiedlicher Spiritualität und Praxis und verschiedenen Ausprägungen von Theologie und Dogma manifestiert.”51 Das Zitat mag die Relevanz eines Aspektes ostkirchengeschichtlicher Forschung erahnen lassen, der in den Rahmen einer Konzeption von Kirchengeschichte als Frömmigkeitsgeschichte zu stellen wäre, wie sie in Marburg namentlich von Winfried Zeller und Bernd Jaspert vertreten wurde.52
4. Ostkirchengeschichte bereichert den christlich-islamischen Dialog um die Perspektive der Christen des Ostens.
Die westchristliche Wahrnehmung des Islam oszilliert gewöhnlich zwischen zwei Extremen: Entweder wird der Islam zum fanatisch-fundamentalistischen Aggressor stilisiert, der den Rest der Welt bedroht, oder aber als vorbildlicher Hort religiöser Toleranz glorifiziert. Betrachtet man das Geschick der orientalischen Christenheit seit der arabischen Eroberung des Nahen und Mittleren Ostens, so ergibt sich ein differenzierteres (und authentischeres) Bild.53
Die Lebens- und Glaubensbedingungen von Christen im islamisch geprägten Orient sind ein Forschungsgegenstand, der unzweifelhaft für den christlich-muslimischen Dialog eine Bedeutung eigener Art besitzt. Soll ein solcher Dialog nicht zu einem ahistorischen Artefakt mutieren, ist diese Perspektive einzubeziehen. Dies gilt auch von den Religionsgesprächen, die zwischen christlich-orientalischen und muslimischen Theologen seit frühester Zeit stattgefunden haben. Hier wurden Fragen verhandelt, die bis heute nicht bedeutungslos geworden sind, wenn in einen Dialog eingetreten werden soll. Sidney Griffith fordert nachdrücklich die Berücksichtigung der christlich-orientalischen Perspektive, wenn westliche Theologen das Gespräch mit dem Islam suchen: “Surely this is a more valid perspective from which to begin a Christian ‘thinking into Islam’ than what might a posteriori seem best to a western theologian whose life among Muslims has been under the protection of colonialist or imperialistic power, and not under the less enfranchising protection (adh-dhimmah) of the shari’ah, the heart of the truly Islamic government.”5
Der Erschließung der historischen Quellen zum Zusammenleben von Christen und Muslimen55 ist also ebenso Gegenstand der Ostkirchengeschichte wie auch die Beobachtung gegenwärtiger Lebensbedingungen im Orient und der (erstaunlich zahlreichen) Dialoge, die dort geführt werden. Mit Wolfgang Hage ist die Marburger Ostkirchengeschichte auch im Islam-Arbeitskreis der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vertreten. Besonders erfreulich ist, daß in Marburg studierende orthodoxe Doktoranden aus dem Orient in diesem Kreis mitarbeiten und ihn durch ihre unmittelbare Kenntnis des Islam bereichern. Für manchen westlichen Theologen mag es bei Begegnungen mit orientalischen Christen überraschend sein, daß er nicht nur – und nicht einmal in erster Linie – von Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen erfährt, sondern auch von Gemeinsamkeiten. Das gilt in besonderer Weise für die Haltung der arabischen Christen im Palästina-Konflikt! Das Problem ist zu komplex, als das es hier ausführlich diskutiert werden könnte. Auf jeden Fall kommt dem Fach Ostkirchengeschichte, das sich ja stets auch der Gegenwart verpflichtet weiß, die Aufgabe zu, dieses Problem zu benennen und es in unser europäisch geprägtes theologisches Bewußtsein einzubringen.
5. Schluß
Im Zusammenhang mit dem zuletzt angesprochenen Themenkomplex ist noch auf folgende Gefahr aufmerksam machen, der sich unsere westliche Theologie stets ausgesetzt sieht: Ostchristen reagieren empfindlich darauf, wenn sie vom Westen zu Objekten (und sei es auch zu Objekten unserer Bewunderung oder unserer Forschung) gemacht, aber nicht als gleichwertige Dialogpartner behandelt werden. Diese Erfahrung scheint übrigens auch der schon erwähnte David Chytraeus gemacht zu haben. Nachdem er von dem ausführlichen Briefwechsel zwischen den Tübinger Theologen und dem Ökumenischen Patriarchen Jeremias von Konstantinopel erfahren hatte, adressierte auch er im Jahre 1577 einen Brief an den Patriarchen. Darin brachte er mit vielleicht allzu gönnerhaften Worten seine Freude darüber zum Ausdruck, daß unter den Türken noch Christen lebten. In seinem Antwortschreiben nahm der Patriarch auf diese Äußerung Bezug in einem, wie Dorothea Wendebourg beobachtet hat, “Ton auffälliger Aggressivität”56. Jeremias ließ seinen Rostocker Adressaten nämlich wissen, “wenn auch das griechische Volk in Knechtschaft lebe, so halte es doch an der überlieferten Frömmigkeit fest und sei sehr wohl in der Lage, der Wahrheit des Glaubens gegen alle Angriffe zum Sieg zu verhelfen.”57 Eine Fortsetzung blieb dem Briefwechsel versagt. Dieses historische Detail läßt noch einmal deutlich werden, daß unser Verhältnis zu den Kirchen des Ostens nur das einer echten Partnerschaft sein kann. Dann aber kann sich die Chance des gegenseitigen Gebens und Nehmens ergeben. Vielleicht haben die ausgewählten Beispiele erkennbar werden lassen, wie sich die eingangs zitierte Ansicht Adolf Deissmanns in unterschiedlichster Weise bewahrheiten könnte, daß nämlich der Westen vom Osten etwas zu lernen habe. In diesem Lernen liegt der Sinn des Faches Ostkirchengeschichte in einer Evangelisch-Theologischen Fakultät beschlossen. Oder sagen wir es mit den Worten, die Friedrich Heiler seinem Werk “Urkirche und Ostkirche” voranstellte und denen er mit einem Rufzeichen Nachdruck verlieh: “Ex Oriente Lux!”58
2Deissmann lehrte seit 1897 in Herborn, später in Heidelberg (1907) und ab 1908 schließlich in Berlin.
3Vgl. dazu und zum Folgenden Ernst Benz, Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation bis zur Gegenwart (Orbis Academicus III/1), München 1952, 301-303.
5Adolf Deissmann, Die Stockholmer Bewegung. Die Weltkirchenkonferenz zu Stockholm 1925 und Bern 1926 von innen betrachtet, Berlin 1927, 2.
6Adolf von Harnack, Der Geist der morgenländischen Kirche im Unterschied zu der abendländischen, in: Ausgewählte Reden und Aufsätze, hrsg. von A. von Zahn-Harnack † und A. von Harnack, Berlin 1951, 80-112 (das Zitat S. 103f.; Ersterscheinung in: Aus der Friedens- und Kriegsarbeit, 1916).
7In: Karl Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte Bd. 1: Der Osten, Tübingen 1928, 418-432 (= Die Zukunft 21 [1913] 88-98).
8Deutsche Übersetzung in: Nikolaus Thon, Quellenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche (Sophia 23), Trier 1983; vgl. dazu Erich Bryner, Die Ostkirchen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (KGE III/10), Leipzig 1996, 132f. – In einem Festvortrag von 1929 hat Deissmann diese Enzyklika besonders hervorgehoben, als er auf die Stockholmer Konferenz zu sprechen kam: “…Damit hatte auch der ehrwürdige christliche Osten seine Stimme erhoben und gezeigt, daß auch er in die allgemeine Aufrüttelung der Geister hineingezogen war.” (Die ökumenische Erweckung. Ein Jahrzehnt zeitgenössischer Kirchengeschichte, Rede bei der Feier der Erinnerung an den Stifter der Berliner Universität König Friedrich Wilhelm III. in der Alten Aula am 3. August 1929, Berlin 1929, 24; auf das politische Schicksal der orthodoxen Völker nach dem Ersten Weltkrieg geht Deissmann übrigens S. 12-16 ein).
9Die Stockholmer Weltkirchenkonferenz. Vorgeschichte, Dienst und Arbeit der Weltkirchenkonferenz für Praktisches Christentum 19.-30. August 1925. Amtlicher Deutscher Bericht im Auftrage des Fortsetzungs-Ausschusses erstattet von D. Adolf Deissmann D.D., Berlin 1926, V. – Ein Nachruf auf Patriarch Photios findet sich in Deissmann, Die Stockholmer Bewegung (wie Anm. 5), 173-176.
10Im Jahr 2002 jährt sich zum hundertsten Mal der Geburtstag dieser Wegbereiterin der Ökumenearbeit in der EKD. Hildegard Schaeder, eine Überlebende des Lagers Ravensbrück, die mit einer Dissertation über “Moskau – das dritte Rom” im Fach Slavistik promoviert worden war, wirkte von 1948 bis 1970 als Referentin für die Orthodoxen Kirchen im Frankfurter Außenamt der EKD. Sie war es, die die aufsehenerregende Reise Martin Niemöllers nach Moskau 1952 sowie die Dialoge der EKD mit der Russischen Orthodoxen Kirche vorbereitet hatte. Zugleich lehrte sie bis 1978 als Honorarprofessorin für Geschichte der Orthodoxen Kirchen an der Frankfurter Universität; ihr beachtliches wissenschaftliches Werk (dessen angemessene Erschließung und Würdigung noch aussteht) stand ganz im Zeichen der Kirchengeschichte Osteuropas. Siehe dazu Gerlind Schwöbel, Art. “Schaeder, Hildegard”, BBKL 8 (1994) 1510-1515, sowie dies., Leben gegen den Tod. Hildegard Schaeder: Ostern im KZ, Frankfurt a. M. 21996 (darin S. 109-139 die biographische Skizze von Heinz Joachim Held: “Brückenschlag zur Orthodoxie im Osten” – Erinnerungen an Hildegard Schaeder im Kirchlichen Außenamt). An der Tatsache, daß Hildegard Schaeder an der Gründung des Marburger Lehrstuhles beteiligt war, läßt sich noch einmal besonders deutlich beobachten, wie das historisches Interesse und die aktuelle ökumenische Entwicklung zusammenspielten, als es um die Etablierung des neuen Faches “Ostkirchengeschichte” an einer Evangelisch-Theologischen Fakultät ging.
11Vgl. dazu mit Literaturhinweisen Hans Hartog, Evangelische Katholizität. Weg und Vision Friedrich Heilers, Mainz 1995, 23f.
12“Am Sonnabend vor Konferenzschluß besuchte ich den Patriarchen; ich traf ihn gerade, als er im Zimmer vor einem Madonnenbild mit seinen beiden Begleitern die Vesper betete. Der greise Würdenträger mit seinem ehrwürdigen monastischen Aussehn – er war früher Archimandrit im Sinaikloster – stand während des ganzen Gottesdienstes auf seinen Stab gestützt; er war ganz ins Gebet versunken; und während seine beiden Begleiter wechselweise lange Gebete rezitierten, rief er immer wieder dazwischen die kurzen Responsorien: δόξα σοι, κύριε ελέησον . Ich fühlte, wie nahe dieser verehrungswürdige Greis der Ewigkeit stand. Als ich acht Tage später nach Zürich kam, vernahm ich die Trauerkunde, daß er tags zuvor in dieser Stadt verschieden war.” (Die religiöse Einheit der Stockholmer Konferenz, in: Friedrich Heiler, Evangelische Katholizität. Gesammelte Aufsätze und Vorträge Bd. 1, München 1926 [= Christliche Welt 1.10.1925], 37-56, das Zitat S . 45f.). Zu Heilers Konzeption einer “Evangelischen Katholizität” vgl. neben der Monographie Hartogs (siehe Anm. 11) auch Wolfgang Dietrich, Der ganze Mensch ein Tempel Gottes. Über evangelische und orthodoxe Katholizität, LM 34 (1995) 5-8.
13Vgl. Christian Weise, Art. “Kawerau, Peter”, BBKL 17 (2000) 776-781, sowie die Würdigungen Kaweraus von Wolfgang Hage: “Ostkirchengeschichte” erforscht. Uni gratuliert Prof. Dr. Dr. Peter Kawerau zum 70. Geburtstag, in: Oberhessische Presse 61 (13.3.1985) 3; ders., Prof. Peter Kawerau wurde 70 Jahre alt, in: Marburger Universitätszeitung 168 (18.4.1985) 2; ders.: Der Name Peter Kawerau wird weiterleben. Prof. Dr. Wolfgang Hage zum Tode des Professors für Ostkirchengeschichte, Oberhessische Presse am 23.9.1988 (vgl. von Hage auch die Notiz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr. 220 am 21.9.1988, S. 4, unter “Personalien”).
14Kawerau war sich dieser Herkunft durchaus bewußt; die vier Bände seiner Gesamtdarstellung der Ostkirchengeschichte sind jeweils einem um Wissenschaft und Kirche verdienten Familienmitglied gewidmet (Peter Kawerau, Ostkirchengeschichte Bde. 1-4 [CSCO 451/441/442/456, Sub. 70/64/65/71], Louvain 1983/1982/1982/1984): Bd. 1 dem Vater “Peter Friedrich Theodor Kawerau (1873-1942), Professor am Kloster Unserer Lieben Frauen in Magdeburg”; Bd. 2 dem Großvater “D. Dr. Gustav Kawerau (1847-1918), Propst an St. Petri in Berlin, Geheimer Ober-Konsistorialrat im Evangelischen Ober-Kirchenrat in Berlin” (ihm hat Kawerau auch ein kleines Denkmal gesetzt in: Neue Deutsche Biographie 11 [1977] 378); Bd. 3 dem Großonkel “Dr. phil. h.c. Georg Kawerau (1856-1909), Direktoralassistent am Deutschen Archäologischen Institut in Konstantinopel”; Bd. 4 dem Onkel “Dr. Siegfried Kawerau (1886-1936), Oberstudiendirektor des Köllnischen Gymnasiums und der Kaempfrealschule Berlin”.
15Die jakobitische Kirche im Zeitalter der syrischen Renaissance. Idee und Wirklichkeit (BBA 3), Berlin 1955.
16Melchior Hoffman als religiöser Denker, Haarlem 1954. An prominenter Stelle begegnet Hoffman später auch in Kaweraus Darstellung der Wurzeln des modernen ökumenischen Gedankens im Täufertum, dem protestantischen Spiritualismus, dem radikalen Pietismus und dem amerikanischen Revival: Die ökumenische Idee seit der Reformation (Urban-TB 114), Stuttgart 1968, 20-29.
17Amerika und die orientalischen Kirchen. Ursprung und Anfang der amerikanischen Mission unter den Nationalkirchen Westasiens (AKG 31), Berlin 1958. Vgl. zu diesem Thema auch Kaweraus Aufsätze: Motive der amerikanischen Weltmission, DtPfrBl 54 (1954) 316-318. 340-342, und: Amerika und die Orientalischen Kirchen, DtPfrBl 59 (1959) 100-102. 127f. Später verfaßte Kawerau übrigens den Abschnitt über die Kirchengeschichte Nordamerikas in: Peter Kawerau/Martin Begrich/Manfred Jacobs, Amerika (KIG IV S), Göttingen 1963, 1-22.
18So erstattete Spuler beispielsweise über Jahre hinweg in der Internationalen Katholischen Zeitschrift (Bern) Bericht über die aktuelle Entwicklung der Ostkirchen; siehe dazu auch seine übergreifende Darstellung: Gegenwartslage der Ostkirchen in ihrer nationalen und staatlichen Umwelt, Frankfurt/Main 21968.
19Das gilt auch im Hinblick auf die Erforschung des evangelischen Christentums in Osteuropa, die im Ostkircheninstitut in Münster von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt hat. Siehe dazu Robert Stupperich, Das Ostkircheninstitut in Münster, in: Carl Brummack (Hrsg.), Die Unverlierbarkeit evangelischen Kirchentums aus dem Osten. Ertrag und Aufgaben des Dienstes an den vertriebenen evangelischen Ostkirchen, Ulm 1964, 107-112, sowie Peter Hauptmann, 25 Jahre Ostkircheninstitut in Münster, KO 26 (1983) 180-191 (bes. 181f.). Teilweise ähnlich orientiert waren die ostkirchengeschichtlichen Arbeiten von Eduard Steinwand († 1960), der als Praktischer Theologe in Erlangen auch Theologie des Christlichen Ostens lehrte und als Vorläufer des 1966 dort gegründeten Seminars für “Geschichte und Theologie des Christlichen Ostens” gelten kann; vgl. von Steinwand: Glaube und Kirche in Rußland. Gesammelte Aufsätze von Eduard Steinwand, Göttingen 1962 (vgl. darin bes. S. 71ff. “Was kann die lutherische Kirche von der Ostkirche lernen?”, S. 112ff. “Luthertum und orthodoxe Kirche”, S. 139ff. “Versunkenes Luthertum im Osten”, und S. 149ff. “Traugott Hahn d. J.”). Der Plan, das Forschungsgebiet des östlichen evangelischen Christentums auch am neu gegründeten Marburger Seminar zu pflegen, wurde von Kawerau nicht aufgegriffen. Immerhin steuerte er zum Reformationsjubiläum 1967 den Aufsatz bei: Die Reformation in Ost- und Südosteuropa, in: Reformation und Gegenwart. Vorträge und Vorlesungen von Mitgliedern der Theologischen Fakultät Marburg zum 450. Jubiläum der Reformation
(MThSt 6), Marburg 1968. Auch im vierten Band seiner “Ostkirchengeschichte” (siehe Anm. 14) behandelt Kawerau die Reformation im Osten (in Kap. 2: “Westliche Einflüsse”, S. 13-42).
20Vgl. dafür den instruktiven Überblick bei Hans-Martin Barth. Von Barth werden neben Heiler, Benz und dem ostkirchengeschichtlichen Lehrstuhl auch das Engagement der Marburger Professoren Wolfgang A. Bienert und Jörg Jeremias in Dialogen zwischen EKD und orthodoxen Kirchen sowie die Forschungsstelle Ökumenische Theologie genannt, in der Barth selbst mitarbeitet. – Im Blick auf das ostkirchengeschichtliche Seminar sprechen die Herausgeber der Wolfgang Hage dedizierten Festschrift von “so etwas wie eine[r] kleine[n] Familie der Hage-Schüler auf der von Kawerau und Spuler sich gründenden Tradition”: Martin Tamcke/Wolfgang Schwaigert/Egbert Schlarb (Hrsg.), Syrisches Christentum weltweit. Studien zur syrischen Kirchengeschichte (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 1), Münster 1995, 11.
21Siehe dazu Peter Kawerau, Zur Kirchengeschichte Asiens, in: G. Hoffmann/K. H. Rengstorf (Hrsg.), Stat crux dum volvitur orbis (Fs H. Lilje), Berlin 1959, 68-76; ders., Allgemeine Kirchengeschichte und Ostkirchengeschichte, ZRGG 14 (1962) 305-315, sowie Wolfgang Hage, Die oströmische Staatskirche und die Christenheit des Perserreiches, ZKG 84 (1973) 174-187 (hier: 187). Vom Anliegen, den Blick nicht einseitig auf die abendländische Vergangenheit zu verengen, ist nicht zuletzt das Lehrbuch von Wolfgang Hage gekennzeichnet: Das Christentum im frühen Mittelalter (476 -1054). Vom Ende des weströmischen Reiches bis zum west-östlichen Schisma (Zugänge zur Kirchengeschichte 4), Göttingen 1993 (siehe darin bes. Kap. II: “Das Christentum im Orient und der Islam”, S. 29-50, und Kap. VI: “Östliche und westliche Christenheit”, S. 147-163). Wie erhellend es sein kann, abendländische, byzantinische und syrische Kirchengeschichte unter einer bestimmten Fragestellung im Querschnitt zu betrachten, demonstriert Wolfgang Hage zuletzt in: Kalifenthron und Patriarchenstuhl. Zum Verhältnis von Staat und Kirche im Mittelalter, in: Wolfgang Breul-Kunkel/Lothar Vogel, Rezeption und Reform (Fs Hans Schneider) (Quellen und Studien zur hessischen Kirchengeschichte 5), Darmstadt 2001, 3-17 (hier: 16).
22Siehe dazu die prägnante Darstellung seines kirchenhistorischen Ansatzes in: Peter Kawerau, Einführung in das Studium der Ostkirchengeschichte, Marburg 1984, 1-6. Dieser Ansatz habe ihn gezwungen, beim Aufbau des Marburger Seminars eine “Creatio ex Nihilo” vorzunehmen (ebd. 5).
25So Wolfgang Hage in dem nicht publizierten Vortrag “Die orientalischen Kirchen in kirchengeschichtlichen Lehrbüchern”, gehalten auf dem 1. Deutschen Syrologensymposium, Hermannsburg 1998.
26Siehe dazu für das 4./5. Jahrhundert Wolfgang Hage, Die oströmische Staatskirche (wie Anm. 21). Für einen Gesamtüberblick über die Geschichte der Apostolischen Kirche des Ostens siehe Wolfgang Hage, Apostolische Kirche des Ostens (Nestorianer), in: Friedrich Heyer, Konfessionskunde, Berlin-New York 1977, 202-214, sowie ders., Art. “Nestorianische Kirche”, TRE 24 (1994) 264-276.
27Vgl. Wolfgang Hage, Der Weg nach Asien: Die ostsyrische Missionskirche, in: Kirchengeschichte als Missionsgeschichte Bd. 2,1: Die Kirche des früheren Mittelalters, hg. von Knut Schäferdiek , München 1978, 360-393.
28Zur jüngeren Kirchengeschichte der Apostolischen Kirche des Ostens siehe auch Wolfgang Hage, Die Syrisch-Orthodoxe Kirche und die Apostolische Kirche des Ostens. Aspekte ihrer Geschichte, IKZ 21 (1992) 209-218 (hier: 216-218).
29Walter Engels, Die Wiederentdeckung und erste Beschreibung der östlich-orthodoxen Kirche in Deutschland durch David Chytraeus (1569), Kyrios 4 (1939/40) 262-285 (das Zitat S. 262). Vgl. dazu und zum Folgenden auch Gottfried Holtz, David Chytraeus und die Wiederentdeckung der Ostkirche, WZ(R).GS 2 (1952/53 Nr. 2), 93-101; Friedrich Heyer , David Chytraeus als Erforscher der Orthodoxie, in: Martin Batisweiler/Karl Christian Felmy/Norbert Kotowski (Hrsg.), Der Ökumenische Patriarch Jeremias II. von Konstantinopel und die Anfänge des Moskauer Patriarchates (Oikonomia 27), Erlangen 1991, 141-145.
31So über das Fach “Christlicher Orient” Alexander Böhlig, Miszellen zu εϣϫε, in: Lingua Restituta Orientalis. Festgabe für Julius Aßfalg, hg. von Regine Schulz und Manfred Görg (Ägypten und Altes Testament 20), München 1990, 52-58 (hier: 52).
34Die Bedeutung der Konfessionskunde für das Theologiestudium und für das Pfarramt, in: Kirche und Kosmos. Orthodoxes und evangelisches Christentum (Studienheft Nr. 2), hg. vom Kirchlichen Außenamt der EKD, Witten/Ruhr 1950, 28-44 (das Zitat S. 30).
37Ebd., 43f. – Der Teilnahme der orthodoxen Kirchen am ökumenischen Dialog galt stets die Aufmerksamkeit von Ernst Benz. Die russische Kirche, die sich erst auf der Weltkirchenkonferenz in Neu Delhi 1961 zur Mitarbeit im Ökumenischen Weltrat der Kirchen entschließen konnte, steht im Zentrum des Beitrages: Die gegenwärtige Stellung der Östlich-Orthodoxen Kirche in der Ökumene, in: Ernst Benz, Die russische Kirche und das abendländische Christentum, München 1966, 39-73. Die interkonfessionellen Beziehungen zwischen östlichen und westlichen Kirchen werden ferner dargestellt bei Friedrich Heiler, Die Ostkirchen, München-Basel 1971, 414-421. Zu neueren Entwicklungen siehe Wolfgang A. Bienert, Der Dialog zwischen dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel und der EKD, ÖR 36 (1987) 33-49, und ders., Erwartungen an die griechisch-orthodoxe Kirche im geeinten Europa – aus protestantischer Sicht, MDÖC 1992/III, 26-35.
38Vgl. dazu Barth, Marburg (wie Anm. 20), 54-56. Als Motor dieser Kirchenfreundschaft ist Pfarrer Georg Richter (Kassel), Studienleiter i.R. der Evangelischen Akademie Hofgeismar, anzusprechen; er wirkte selbst einige Jahre als Pfarrer in Beirut. Durch ihn ist es zu einer Reihe von anregenden Tagungen in Hofgeismar gekommen, die sich mit der Lage der Christen im Vorderen Orient beschäftigt haben und auf denen teils hochrangige Vertreter der rum-orthodoxen Kirche Antiochiens als Gäste begrüßt werden konnten. Vgl. etwa Georg Richter (Hrsg.), Religion und Religionen in Syrien (Hofgeismarer Protokolle 318), Hofgeismar 1999 (mit Beiträgen über die christlichen Konfessionsfamilien in Syrien: Zur heutigen Situation von Georg Richter S. 43-58, zu ihren historischen und systematischen Wurzeln von Wolfgang Hage S. 59-73).
39Vgl. dazu Wolfgang A. Bienert, Die Bedeutung der Kirchenväter im Dialog zwischen der EKD und Orthodoxen Kirchen, ÖR 44 (1995) 451-472.
41Georges Tamer, Ex oriente lux? Ein Nachwort, in: Die Zukunft der orientalischen Christen. Eine Debatte im Mittleren Osten, hg. vom Evangelischen Missionswerk in Deutschland (EMW), dem Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten (INAMO) und Alexander Flores, Hamburg-Berlin 2001, 128-134.
42Hier ist der Ort, an die Tübinger Antrittsvorlesung von Alexander Böhlig (erschienen nur vier Jahre nach Gründung des Marburger Seminars) zu erinnern: Der christliche Orient als weltgeschichtliches Problem, ZRGG 17 (1965) 97-114: Böhlig beschließt seine historische tour d’horizont über die Leistungen der orientalischen Christenheit mit dem Aufruf an die abendländischen Christen, ihren bedrängten orientalischen Glaubensbrüdern der Gegenwart mit aufrichtiger Anteilnahme und Hilfsbereitschaft zu begegnen: “Wir haben gesehen, daß wir der orientalischen Christenheit mancherlei verdanken; so wollen auch wir uns bemühen, ihr etwas zu bieten.” (S. 114).
43Hacik Rafi Gazer, Die Reformbestrebungen in der Armenisch-Apostolischen Kirche im ausgehenden 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts (KO.M 24), Göttingen 1996, 29f. – Zu dem Genozid am armenischen Volk hat Martin Tamcke seine biographisch und quellenkritisch ausgerichtete Marburger Habilitationsschrift vorgelegt: Armin T. Wegener und die Armenier. Anspruch und Wirklichkeit eines Augenzeugen (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 2), Göttingen 1996.
44So wurde etwa 1901-1903 Harnacks “Wesen des Christentums” ins Armenische übersetzt (siehe Gazer, Die Reformbestrebungen [wie Anm. 43], 68-70).
45Das Christentum des Ostens (RM 30), Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1972, 10. Ob Kawerau dabei seine Fakultätskollegen Heiler und Benz im Blick hatte, soll hier dahingestellt bleiben.
46Ebd., 203; aufgegriffen wird diese Aussage von Georg Günter Blum, Vereinigung und Vermischung. Zwei Grundmotive christlich-orientalischer Mystik, OrChr 63 (1979) 41-60 (hier: 41).
47Kawerau, der in dem schon genannten Band “Christentum des Ostens” (siehe Anm. 45) keine Gesamtdarstellung gibt, sondern sich auf ausgewählte, ihm repräsentativ erscheinende Aspekte beschränkt, kommt darin mehrfach auf Themen aus dem Bereich der Spiritualität zu sprechen (vgl. zu Gregor Palamas und dem Hesychasmus S. 120-133, zur Philokalie, dem Jesusgebet und den “Aufrichtigen Erzählungen eines russischen Pilgers” S. 162-186, sowie – damit zusammenhängend – zum Namen-Jesu-Streit zu Beginn des 20. Jahrhunderts S. 187-189). Ein gehaltvolles Kapitel über die Mystik findet sich auch in: Heiler, Die Ostkirchen (wie Anm. 37), 276-293. Heiler hatte auch den Band “Ostkirche und Mystik” von Nicolas von Arseniew in die von ihm herausgegebene Reihe “Aus der Welt christlicher Frömmigkeit” aufgenommen (Bd. 8, München 1925). Einen bedeutenden geistlichen Vater des Athos behandelt die Marburger Dissertation von Klaus Gnoth, Antwort vom Athos. Mönchtum und Gesellschaft. Die Bedeutung des heutigen griechisch-orthodoxen Mönchtums für Kirche und Gesellschaft nach der Schrift des Athosmönches Theoklitos Dionysiatis “Metaxy Ouranou kai Ges” (Zwischen Himmel und Erde) (KiKonf 30), Göttingen 1990. Eine Darstellung orthodoxer Spiritualität gibt auch Hans-Martin Barth, Spiritualität. Ökumenische Studienhefte Bd. 2 (Bensheimer Hefte 74), Göttingen 1993, 21-32.
49Vgl. dazu etwa Georg Günter Blum, Mystische Erfahrung und Theologie im östlichen Christentum, US 43 (1988) 2-17 (bes. S. 3-6 zu Evagrius und Isaak von Ninive, S. 9 zu Dionysius Areopagita, S. 10f. zu Maximus Confessor, S. 11f. zu Symeon dem Neuen Theologen). – Bezeichnend ist beispielsweise, wie Emmanuel Jungclaussen die Rolle der Christus-Ikone für diejenigen beschreibt, die den Weg des kontemplativen Jesus-Gebetes gehen wollen. Die Ikone sei nur am Beginn des Gebetes zu betrachten, um sich der Gegenwart des Herrn bewußt zu werden. Dann aber solle man auf kein Bild mehr schauen, “sondern einfach die bildlose Gegenwart des Herrn zu erfahren suchen” (Unterweisung im Herzensgebet [Koinonia-Oriens 46], St. Ottilien 1999, 57).
50Patriarchen und Einsiedler. Der tausendjährige Athos und die Zukunft der Ostkirche, Düsseldorf-Köln 1964, 205f. (Hervorhebungen im Original).
51Georg Günter Blum, Meditative Praxis und Theologie. Aspekte westlicher und östlicher Spiritualität, OS 28 (1979) 17-30 (das Zitat S. 17). Blums Arbeiten zum Thema sind jetzt zugänglich in: Georg Günter Blum, “In der Wolke des Lichtes”. Gesammelte Aufsätze zu Spiritualität und Mystik des Christlichen Ostens, hg. von Karl Pinggéra (Oikonomia 40), Erlangen 2001.
52Vgl. Bernd Jaspert, Der Kirchenhistoriker Winfried Zeller, Marburg 1999 (zum Ansatz Zellers siehe zusammenfassend S. 26-29), sowie ders., Frömmigkeit und Kirchengeschichte, St. Ottilien 1986.
53Hier zeigt sich zunächst einmal, daß das islamische Recht (wo es Anwendung fand) aus den Angehörigen anderer Religionen in der Tat Bürger zweiter Klasse gemacht hat. Es lassen sich ferner (als Ausnahme von der Regel) einzelne Fälle beobachten, in denen muslimische Herrscher die Konversion ihrer andersgläubigen Untertanen mit mancherlei Druckmitteln forçiert haben. Doch sind hierbei stets starke regionale Unterschiede feststellbar. Auf der anderen Seite verdient es Beachtung, daß dabei (von Ausnahmen wiederum abgesehen) das prinzipielle Existenzrecht von Juden und Christen im Herrschaftsbereich des Islam (dem “Haus des Islam”) respektiert wurde. Siehe dazu etwa Wolfgang Hage, Die syrisch-jakobitische Kirche in frühislamischer Zeit, Wiesbaden 1966, 66-77; ders., Die kirchliche Situation in der frühislamischen Zeit, in: Willi Höpfner (Hrsg.), Die Kirchen im Raum des Islam (ChrIs 1), Breklum 1971, 17-29.
54Sidney H. Griffith, Syriac Writers on Muslims and the Religious Challenge of Islam (Moran Etho 7), Kottayam 1995, 52.
55Vgl. dazu Peter Kawerau, Christlich-arabische Chrestomathie aus historischen Schriftstellern des Mittelalters, Bd. 1,1: Texte; Bd. 1,2: Glossar; Bd. 2: Übersetzung mit philologischem Kommentar (CSCO 370/374/385, Sub. 46/50/53), Louvain 1976/1976/1977 (siehe darin besonders Eutychius von Alexandria zur Übergabe von Damaskus 635 und Jerusalem 638 an die Muslime, Agapius von Hierapolis zu den Anfängen des Islam, Jahja von Antiochia zu Kalif al-Hakim und dem Sinaikloster, Severus von al-Aschmunein zum Aufstand der koptischen Baschmuriten, das Chronicon Orientale zu Patriarch Michael III. von Alexandrien und Sultan Ahmad b. Tulun).
56Dorothea Wendebourg, Reformation und Orthodoxie. Der ökumenische Briefwechsel zwischen der Leitung der Württembergischen Kirche und Patriarch Jeremias II. von Konstantinopel in den Jahren 1573-1581 (FKDG 37), Göttingen 1986, 351. – Zu den evangelischen Beziehungen zur Orthodoxie im Reformationsjahrhundert siehe auch Ernst Benz, Wittenberg und Byzanz. Zur Begegnung und Auseinandersetzung der Reformation und der östlich-orthodoxen Kirche, Marburg 1949 (2. Aufl. München 1971).

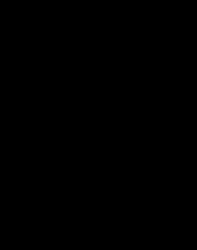 Das Christentum gelangte zunächst ohne Planung vornehmlich durch syrische und persische Kaufleute nach Osten. Das verzweigte Wegenetz der Seidenstraße erschloß alle wichtigen Regionen Zentralasiens nicht nur für den Warenaustausch, sondern auch für die Ausbreitung der Religionen und Kulturen. In dieser polyglotten und multireligiösen Umwelt mußten die Nestorianer ihren Glauben etablieren. Der Anfang wurde in den Städten mit Stützpunkten gemacht, die von nestorianischen Händlern gegründet wurden. Ihnen folgten zur geistlichen Betreuung Priester und Mönche, so daß sich kleine Kerngemeinden bildeten, die gerade durch das konsequente Vorbild der Mönche Anhänger in der einheimischen Bevölkerung gewannen. Die Handelsmetropole Merw besaß seit dem 4. Jh. eine Gemeinde und wurde bald zur Metropolie erhoben, so daß schon sehr früh ein weit östlich der syrischen Lande befindlicher Vorposten für die Mission bestand. Das Bistum Herat machte bereits Ende des 5. Jh. die Bekehrung von Teilen der Hephthaliten möglich. Im Osten gelangte die Mission über Buchara und Samarkand bis an den Balchasch-See. Im 8. Jh. gab es einen nestorianischen Fürsten in Kaschgar, Nestorianer in Khotan, im Norden in Bai und in Tibet, wie Inschriften Durchreisender bei Drangtse zeigen. In dieser Zeit wurden auch Choresm und Sogdien erreicht, bis dahin Bastion des Zoroastrismus, und die dort bekehrten Sogdier halfen als Kaufleute in Merw, West- und Ostturkestan, der Mongolei und China bei der Verbreitung des neuen Glaubens. Für die weitere Ausbreitung ist der Katholikos-Patriarch Timotheos I. (780-823) von größter Bedeutung, da er die Mission systematisch zu organisieren suchte. Er sorgte für die theologische und sprachliche Ausbildung von Missionaren. Er weihte außerdem Bischöfe für die Ostgebiete, so auch für Tibet, in dessen besetzten Gebieten Zentralasiens der Nestorianismus Eingang gefunden hatte. Er wurde jedoch alsbald wieder unterdrückt. Im Norden des Issyk-kul, nämlich im Ili-Tal und im Gebiet von Semirjetschie im Siebenstromland südlich des Balchasch-Sees, wurden nestorianische Friedhöfe mit Hunderten von Grabsteinen gefunden. Im Osten des Tarim-Beckens konnte bei den Uiguren eine Metropolie eingerichtet werden. Anfang des 11. Jh. wurden angeblich 200.000 Kerait-Türken südlich des Baikal-Sees mit ihrem Chaqan getauft. Sie leisteten der Mission großen Vorschub, indem sie selbst das Evangelium verkündeten, mit beträchtlichem Erfolg vor allem bei den Nachbarstämmen wie den Naiman. Die mongolische Hauptstadt Qaraqorum lag im Gebiet der bekehrten Stämme. Die Bischofssitze wurden noch weiter ausgebaut. So erhielten die Chalatsch am Oberlauf des Oxus eine eigene Metropolie.
Das Christentum gelangte zunächst ohne Planung vornehmlich durch syrische und persische Kaufleute nach Osten. Das verzweigte Wegenetz der Seidenstraße erschloß alle wichtigen Regionen Zentralasiens nicht nur für den Warenaustausch, sondern auch für die Ausbreitung der Religionen und Kulturen. In dieser polyglotten und multireligiösen Umwelt mußten die Nestorianer ihren Glauben etablieren. Der Anfang wurde in den Städten mit Stützpunkten gemacht, die von nestorianischen Händlern gegründet wurden. Ihnen folgten zur geistlichen Betreuung Priester und Mönche, so daß sich kleine Kerngemeinden bildeten, die gerade durch das konsequente Vorbild der Mönche Anhänger in der einheimischen Bevölkerung gewannen. Die Handelsmetropole Merw besaß seit dem 4. Jh. eine Gemeinde und wurde bald zur Metropolie erhoben, so daß schon sehr früh ein weit östlich der syrischen Lande befindlicher Vorposten für die Mission bestand. Das Bistum Herat machte bereits Ende des 5. Jh. die Bekehrung von Teilen der Hephthaliten möglich. Im Osten gelangte die Mission über Buchara und Samarkand bis an den Balchasch-See. Im 8. Jh. gab es einen nestorianischen Fürsten in Kaschgar, Nestorianer in Khotan, im Norden in Bai und in Tibet, wie Inschriften Durchreisender bei Drangtse zeigen. In dieser Zeit wurden auch Choresm und Sogdien erreicht, bis dahin Bastion des Zoroastrismus, und die dort bekehrten Sogdier halfen als Kaufleute in Merw, West- und Ostturkestan, der Mongolei und China bei der Verbreitung des neuen Glaubens. Für die weitere Ausbreitung ist der Katholikos-Patriarch Timotheos I. (780-823) von größter Bedeutung, da er die Mission systematisch zu organisieren suchte. Er sorgte für die theologische und sprachliche Ausbildung von Missionaren. Er weihte außerdem Bischöfe für die Ostgebiete, so auch für Tibet, in dessen besetzten Gebieten Zentralasiens der Nestorianismus Eingang gefunden hatte. Er wurde jedoch alsbald wieder unterdrückt. Im Norden des Issyk-kul, nämlich im Ili-Tal und im Gebiet von Semirjetschie im Siebenstromland südlich des Balchasch-Sees, wurden nestorianische Friedhöfe mit Hunderten von Grabsteinen gefunden. Im Osten des Tarim-Beckens konnte bei den Uiguren eine Metropolie eingerichtet werden. Anfang des 11. Jh. wurden angeblich 200.000 Kerait-Türken südlich des Baikal-Sees mit ihrem Chaqan getauft. Sie leisteten der Mission großen Vorschub, indem sie selbst das Evangelium verkündeten, mit beträchtlichem Erfolg vor allem bei den Nachbarstämmen wie den Naiman. Die mongolische Hauptstadt Qaraqorum lag im Gebiet der bekehrten Stämme. Die Bischofssitze wurden noch weiter ausgebaut. So erhielten die Chalatsch am Oberlauf des Oxus eine eigene Metropolie.
Neueste Kommentare