Leider ist der Eintrag nur auf العربية, Español, Italiano und Français verfügbar.
Mär 19 2013
Harald Suermann (Hg.), Naher Osten und Nordafrika (= Erwin Gatz (Hg.), Kirche und Katholizismus seit 1945, Band 7)
Harald Suermann (Hg.), Naher Osten und Nordafrika (= Erwin Gatz (Hg.), Kirche und Katholizismus seit 1945, Band 7), Paderborn: Ferdinand Schöningh 2010, XX + 255 S.. ISBN 978-3-506-74465-4, EUR 39,90.
Der Titel des Buches verspricht Aufschluss über die aktuelle Situation der katholischen Kirche im Nahen Osten und Nordafrika. Der Herausgeber möchte die jüngste Geschichte und die Gegenwart der Kirche in diesen Regionen aufzeigen. Suermann wählt einen durch die Geographie bestimmten Ansatz. Es wird nicht die Geschichte der einzelnen Kirchen losgelöst beschrieben, sondern anhand der einzelnen Staaten werden die jeweiligen katholischen Partikularkirchen behandelt. Jede Kirche hat ihre eigene Geschichte und trotz der Vielfalt in einem Land wie im Libanon kann nicht von einer gemeinsamen Geschichte gesprochen werden, der Band wirft einen „umfassenden Blick auf die neuere Geschichte aller katholischen Teilkirche in einem Land im Kontext der anderen Kirchen“ (Vorwort). Der Herausgeber stellt die Fakten in den Vordergrund, die Theologie, Liturgie, Literatur, Spiritualität, Mönchstum und Mission der einzelnen Kirchen werden nicht mitbehandelt.
In der Einleitung gibt Suermann einen Überblick über die einzelnen Kirchen in den islamischen Staaten. Er skizziert den geschichtlichen Hintergrund der Entstehung der Kirchen und ihren jeweiligen hierarchischen Vertretungen, wobei er die Kirchen für den Nahen Osten in vier Kirchengruppen aufteilt: vorephesenisch, vorchalzedonensisch, chalzedonensisch-orthodox und katholisch. Ein leicht vereinfachendes Schaubild verdeutlicht diese Einteilung (S. 4). Zu der Gruppe der vorephesenischen Kirchen gehören die alte Kirche des Ostens und die apostolische Kirche des Ostens. Letztere hat das Patriarchat nach Chicago verlegt, mit Bischöfen im Irak, Iran, Libanon, Syrien, Indien, Australien, Neuseeland, Europa und Nordamerika. Sie spaltete sich 1972 in die „Heilige apostolische und katholische Kirche des Ostens“ und in die „Alte apostolische und katholische Kirche des Ostens“ auf, mit Patriarchensitz in Bagdad. Hier wird gleich eine Entwicklung aller katholischen Kirchen im Nahen Osten angesprochen, die Abnahme der Mitgliederzahlen aufgrund der Abwanderung der christlichen Familien und die daraus folgende Anpassung der kirchlichen Strukturen, der Mittelpunkt der Kirchen verlagert sich und damit auch teilweise der Ort der Patriarchensitze (S. 7). Die gemeinschaftlichen Institutionen und die Ursprünge der ökumenischen Arbeit im Nahen Osten werden aufgezeigt, wie der Mittelöstliche Rat der Kirchen (MECC) oder die gemeinsamen katholischen Einrichtungen, so der Rat der katholischen Patriarchen des Orients (CPCO).
Im zweiten Kapitel widmet sich Herman Teule (Nimwegen/Löwen) den verschiedenen katholischen Teilkirchen in der Türkei nach 1945, der Griechisch-Katholischen; den Chaldäer; der Syrisch-Katholischen; der Armenisch-Katholischen; der Bulgarisch-Katholischen, den Maroniten und den „Lateinern“. Detailliert zeichnet er die heutige Situation der einzelnen Kirchen auf, beispielsweise besitzen die verarmten Chaldäer keine eigene Kirche in Istanbul und benutzen die Kirche der griechisch-katholischen Gemeinde, die seit 1996 ohne Geistlichen ist (S. 42).
Suermann erschließt im dritten Kapitel die Lage im Irak. Dort ist die chaldäische Kirche im Gegensatz zur Türkei mit etwa 200 000 bis 330 000 Gläubigen die größte, sie hat ihren Sitz in Bagdad. Viele Mitglieder sind jedoch nach den Golfkriegen ins Ausland geflohen (S. 54). Im vierten Kapitel erkundet Teule Syrien und bezieht einige neuere bedeutende Ereignisse mit ein, wie den Besuch von Papst Johannes Paul II. im Mai 2001. (S. 104). Im nächsten Kapitel wird durch Suermann der besonderen Situation im Libanon Rechnung getragen. Libanon ist bis heute von einer Vielfalt christlicher Konfessionen geprägt (S. 105). Anfangs werden die zwölf christlichen Konfessionen vorgestellt, um dann die Geschichte des Libanon verbunden mit der Kirchengeschichte zu erörtern. Die katholischen Rituskirchen, die Maroniten, Melkiten, katholischen Armenier, katholischen Syrer, Chaldäer und Lateiner führen seit 1967 eine jährliche Versammlung der katholischen Patriarchen und Bischöfe des Libanon, Association des Patriarches et Èveques Catholiques du Liban (APECL) durch, womit ihre Position im Land gestärkt wird (S. 119). Ausführlich wird der Bürgerkrieg behandelt und die Verbindung zwischen Kirchenhierarchie, Politik und Militär aufgezeigt. Im Libanon spielt die Auswanderung eine große Rolle, es leben mehr Maroniten Ausland als im Land selbst. Seit Anfang 2000 finden verstärkt ökumenischen Aktivitäten statt, wie das Treffen der Mitglieder der Association des Instituts de Théologie du Moyen-Orient (ATIME) in Kaslik (S. 133). Die Ausführungen enden mit dem Jahr 2006. Im sechsten Kapitel wird vom gleichen Autor Jordanien vorgestellt. Ein Abschnitt behandelt die „tribale Struktur der jordanischen Christen“ und somit die Lebenswirklichkeiten der Christen und die Entfremdung zwischen Gemeinde und Hierarchie (S. 139-140). 1980 wurde die Königliche Forschungsakademie für die Islamische Zivilisation (Aal-Albeit Foundation) gegründet, Leiter ist Prinz Hassan ibn Talal. Er veröffentlichte 1994 in Amman sein Buch „Christainity in the Arab World“, in dem die jordanischen Christen als integraler Bestandteil der arabischen Gesellschaft bestätigt werden (S. 143). Prinz Hassan ibn Talal wirkte am Brief „an den Papst und die ganze Christenheit“ der 138 Muslime an Papst Benedikt XVI am 13. Oktober 2006 mit. Die Situation der katholischen Kirche im Staate Israel und der besetzten Gebiete Palästinas wird im siebten Kapitel von Rainer Zimmer-Winkel (Berlin) erörtert. Er wählt als Titel den Begriff „Heiliges Land“, da diese Bezeichnung direkt auf den christlichen Bezug hinweist (S. 148). Für dieses Kapitel gibt es eindeutig die beste Quellenlage, die jedem Kapitel vorangestellt Bibliographie beinhaltet hier zahlreiche Werke mit einem Erscheinungsdatum ab 2000. Nach einem historischen Überblick ab 1917 bis zum jüngsten Besuch Benedikts XVI im Mai 2009 wird die aktuelle Organisationsstruktur der sieben katholischen Riten in Auswahl vorgestellt. Bedeutsam im Hinblick auf den Platz in der Gesellschaft und den kirchenrechtlichen Konsequenzen war die gemeinsame Synode aller katholischen Rituskirchen des Heiligen Landes in den Jahren 1995-2000 (S. 156). Einrichtungen neueren Datums werden ebenfalls aufgezeigt, wie die Katholische Ordinarienversammlung Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land (A.O.C.T.S.) seit 27. Januar 1992 (S. 159), aber auch die Custodia Terrae Sanctae (Franziskaner), die seit 1217 ansässig ist (S. 161). Wie in jedem Kapitel werden die sozialen Werke und Einrichtungen skizziert, wie Schulen und Krankenhäuser, hier kommt die kirchliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hinzu. Zimmer-Winkel stellt u.a. Proche-Orient Chrétien vor, eine seit 1951 in Trägerschaft der Weißen Väter (Konvent St. Anne) und heute in Kooperation mit dem Institut für Religionsstudien der libanesischen Universität St. Joseph erscheinende Vierteljahreszeitschrift, die er als eine der besten ihrer Art charakterisiert (S. 171). Suermann greift im Kapitel über den Libanon vorrangig auf diese Zeitschrift zurück. Das kürzeste Kapitel ist das von Suermann über die Arabischen Halbinsel, das Apostolische Vikariat von Arabien (seit 1889) und das Apostolische Vikariat von Kuwait (seit 1954). Suermann geht auf den Jemen, Bahrain, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait ein. Deutlich wird hier die Verbindung zwischen der Anwesenheit der katholischen Kirche und dem Aufbau sozialer Einrichtungen (S. 176). Die Globalisierung ist grundlegend für die katholische Kirche auf der arabischen Halbinsel, die Einwanderung der Gastarbeiter, wie aus Philippinien oder Indien machte den Bau neuer Kirchen und die Anwesenheit Geistlicher der unterschiedlichen Riten notwendig. 2007 besuchte König Abdullah ibn Abdel-Aziz Al Saud von Saudi-Arabien als erster saudischer König Papst Benedikt XVI. (S. 183). Im neunten Kapitel geht Suermann auf Ägypten ein und leitet so über zu Nordafrika. Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte ab dem 19. Jahrhundert stellt er die Bedeutung der Verfassung ab 1952 und die gesellschaftliche Position der Christen dar (S. 190-194). Nach der Beschreibung des christlich-islamischen Dialogs erfolgt die Vorstellung der katholischen Teilkirchen, neben Lateiner sind das die koptisch-katholische Kirche, die griechisch-katholische melkitische, die Maroniten, Chaldäer, die katholische Syrer und armenische Katholiken (S. 206). Zu erwähnen sind die 39 Frauenkongretationen der verschiedenen Riten, die sich zur Union des Supérieures majeures d’Egypte (U.S.M.E.) zusammengeschlossen haben (s. 203). Anschließend geht Suermann im nächsten Kapitel auf den Maghreb ein. Vorab benennt er die gemeinsamen Charakteristika wie die Prägung durch die Kolonialzeit und die bis auf Algerien ausschließliche aus Ausländern, meist aus südlicher afrikanischen Ländern, bestehende Anwesenheit von Christen in Libyen, Tunesien und Marokko und dem damit verbundene Wegfall von unterschiedlichen Riten (S. 212). Die Bischöfe Nordafrikas gründeten die Conférence des Évêques de la Region Nord de L’Afrique (C.E.R.N.A.). Die einzelnen Staaten werden jeweils auf drei bis vier Seiten erörtert, dies läßt sich einerseits durch die Nicht-Existenz der katholischen Kirche als auch auf die schwierige Quellenlage zurückführen. Einzig Algerien wird etwas ausführlicher behandelt, neben der periodischen Einteilung der Geschichte ab 1940 wird das u.a. vom Erzbischof von Algier, Henri Teissier vom 1.–7. April 2001 in Algier und Annaba organisierte internationale Augustinus-Kolloquium erwähnt, welches die Heimat dieses bedeutenden Theologen und Philosophen hervorhob und Perspektiven für einen Dialog eröffnete (S. 228). Am 24. Mai 2008 wurde Ghaleb Moussa Abdallah Bader, ein arabischer Christ aus Jordanien, Erzbischof von Algier (S.229). In Marokko ist die katholische Kirche durch zwei Erztümern vertreten, in Tanger und Rabat. Seit dem Regierungsantritt von König Muhammad VI. am 30. Juli 1999 öffnete sich das Land und damit das Verhältnis zur katholischen Kirche (S. 233). Im abschließenden Kapitel, überschrieben als Schlussbemerkungen, zieht Suermann die Quintessenz der aktuellen Lage der Christen im Nahen Osten und in Nordafrika. Er konstatiert eine schwierige Lage und ein mögliches Ende der traditionellen katholischen Kirche, gleichzeitig jedoch einen Ausblick auf einen neuen Dialog mit den islamischen Länden und einem möglichen Neuaufbau katholischer Gemeinden (S. 241). Ein Namensregister, Ortsregister, Sachregister und Autorenverzeichnis schließen das Buch ab. Ein Verzeichnis der Abkürzungen und ein hilfreiches Glossar finden sich am Anfang des Buches.
Insgesamt liegt hier eine gelungene Übersicht über die katholische Kirche in dieser Region vor und ist als Einstieg in das Thema zu empfehlen. Kritisch zu beurteilen ist die stellenweise Benutzung einer einzigen Quelle (Libanon) und die Zurückhaltung bei der Nutzung von internationalen Datenbanken und (arabischen, syrischen, griechischen etc.) Homepages der einzelnen Kirchen und Gemeinden.
Suermann hofft, mit dem Buch ein lebendiges Interesse an den Christen im Nahen Osten und in Nordafrika zu wecken. Das Buch kommt angesichts der massiven Veränderungen im Maghreb und im Nahen Osten zur rechten Zeit, wird jedoch teilweise von diesen überrollt, da 2010 Redaktionsschluss war. Wünschenswert wäre daher eine Ergänzung der Beschreibungen seit dem arabischen Frühling in Form von einem Aufsatz.
Verena Böll
Feb 19 2013
Hüseyin I. Cicek, Martyrium zwischen Gewalt und Gewaltfreiheit. Eine Kriteriologie im Blick auf Christentum, Islam und Politik
Hüseyin I. Cicek, Martyrium zwischen Gewalt und Gewaltfreiheit. Eine Kriteriologie im Blick auf Christentum, Islam und Politik (Beiträge zur mimetischen Theorie. Religion – Gewalt – Kommunikation – Weltordnung 31), Lit-Verlag Münser, 2010 (Zugl. Innsbruck, Univ., Diss., 2010) ISBN 978-3-643-50318-3. 219 S.
Der französische Literaturwissenschaftler, Kulturanthropologe und Religionsphilosoph René Girard ist Autor der mimetischen Theorie, dessen Kernaussage ist, dass das natürliche Nachahmungsbegehren des Menschen zu Gewalt führt, die sich vorübergehend durch einen Sündenbock stoppen lässt. Die Gewaltmechanismen sind dem Menschen verborgen, erst die allmähliche Offenlegung deckt diese auf. Dieser Mechanismus ist Ursprung und Kern der Religion. Die Offenlegung der Mechanismen beginnt mit der der jüdisch-christlichen Tradition und findet im Kreuzesstod Christ ihre Vollendung. Damit kommt dem Christentum die zentrale Bedeutung für die Überwindung der Gewalt zu.
Das hier zu besprechende Werk nimmt die mimetische Theorie zur Grundlage für die Analyse des Martyriums in Christentum, Islam und Politik. Das Werk ist in einer Reihe verschiedener Untersuchungen von Religion und Gesellschaft auf der Grundlage der mimetischen Theorie veröffentlicht. Die mimetische Theorie wurde in Deutschland erst seit Raymund Schwagers Werk „Brauchen wir einen Sündenbock?“ (1978) zunächst zögerlich rezipiert.
Nach einem Vorwort (11) und einer Einleitung (13-15) stellt der Autor noch eine „Kurze Vorgeschichte der Kriteriologie des jüdischen Martyriums“ (17-32) voran. Die jüdischen Martyriumskriterien sind danach von den beiden anderen abrahamitischen Religionen übernommen und uminterpretiert oder verworfen worden (11). Gemäß den Märtyrerakten gibt es fünf Kriterien für das jüdische Martyrium:
- Mächte, die den Juden das Leben gemäß ihrer Schrift verbieten
- Treue der Juden gegenüber der Thora trotz ihres Status
- Gewaltanwendung, welche die Juden untreu werden lässt
- Martyrium aufgrund der Treue zu Thora/Gott in den drei Fällen Götzendienst, Unzucht und Mord
- Die Gewissheit, dass Gott die Haltung der Gläubigen zur Kenntnis nimmt und belohnt und Gottes Rache über die Mörder kommt (22).
Bei weiteren Untersuchungen der Texte kommt der Autor zu dem Schluss, dass die Juden nicht nur als Zeugen des wahren Glaubens sterben sondern auch stellvertretend für das eigene Volk, dessen Sünden so gesühnt werden (25). Damit kommt der Autor zu einem Kerngedanken der mimetischen Theorie.
Im darauf folgenden Kapitel „Auf der Suche nach einer Kriteriologie des christlichen Martyriums“ (33-76) stellt der Autor zunächst die sieben Kriterien vor, die er in den Märtyrerakten gefunden hat, bevor er sie an zwei Beispielen (Polykarp und Christian de Chergé) verifiziert:
- Das Martyrium kann einen Christen in christlicher und nicht-christlicher Umgebung ereilen.
- Das christliche Martyrium ist mehr ein Tat-, denn ein Wortzeugnis
- Der gewaltsame Versuch, den Christen davon abzuhalten, Christus zu folgen
- Der gewaltsame Tod aufgrund der Treue zu Jesus
- Fürbitte und Vergebung für die Peiniger und die gesamte Menschheit
- Ablehnung jeglicher Gewaltanwendung
- Das Erleiden des gewaltsamen Todes (35).
Für den Autor ist ein entscheidender Unterschied zu dem jüdischen, wie auch später zum islamischen Martyrium, dass es hier nicht um die Treue zu einer Schrift oder einem Gesetz geht, sondern um die Treue zu einem Menschen, der selbst das Martyrium erfahren hat. Es geht also um die Imitatio Christi in seiner Treue und Gewaltlosigkeit (38).
Quasi in einem Exkurs stellt der Autor dann die dramatische Theologie Raymund Schwagers dar, der als einer der ersten deutschsprachigen Theologen die mimetische Theorie auf das Leben und Sterben Christi angewendet hat (47-59). Im Lichte des Evangeliums, aber vor allem auch im Lichte der mimetischen Theorie deutet der Autor dann die christlichen Martyrien als eine Aufdeckung der Gewaltstrukturen. Sie legen letztlich offen, dass die Gewalt nicht von Gott, sondern vom Menschen kommt. Gott braucht auch keine Märtyrer, damit gibt es auch keinen Stellvertretungsgedanken im christlichen Martyrium (60-69). Zum Schluss fügt er noch das Beispiel eines modernen christlichen Märtyrers aus der Nazi-Zeit an (69-76).
Im nächsten Kapitel „Auf der Suche nach der Kriteriologie im islamischen Martyrium“ erarbeitet der Autor zunächst anhand von Märtyrererzählungen aus verschiedenen Epochen die Kriterien für ein islamisches Martyrium (77-103). Er berücksichtigt dabei sowohl schiitische als auch sunnitische Traditionen. Die sehr disparaten Erzählungen lassen sich auf den gemeinsamen Nenner „auf dem Weg Allahs gestorben“ bringen, wobei der Weg ausgesprochen verschieden sein kann. Es muss noch nicht einmal zu einer gewaltsamen Tötung kommen. Am Ende der Betrachtung stellt er sechs Kriterien für ein islamisches Martyrium dar:
- Muslims können auf islamischen wie auf nicht-islamischen Territorien Märtyrer werden
- Jeder Muslim kann Märtyrer werden auch ohne kriegerische Auseinandersetzung
- Das Martyrium gründet auf der Treue zur Schrift/zu Gott
- Es besteht die Gewissheit, dass Gott die Haltung der Märtyrer zur Kenntnis nimmt und belohnt, und gleichzeitig wird auf die Rache Gottes an den Übeltätern gehofft.
- Das Martyrium darf aktiv gesucht werden
- Märtyrer kommen sofort ins Paradies (102-103).
Das Kapitel „Auf der Suche nach einer Kriteriologie des politischen Martyriumsverständnisses“ (105-139) untersucht den dritten hier zu behandelnden Bereich. In einem ersten Teil beschreibt der Autor, was unter einem politischen Mätrtyrer zu verstehen ist, nämlich „eine Person, die sich auf Gedeih und Verderb für die Gemeinschaft eingesetzt hat. Für die Gesellschaft, der die Person angehört, sind ihre Taten Ausdruck höchster Liebe … Somit dienen die politischen Märtyrer als Advokaten der Wahrheit, die die Gemeinschaft in ihrem Sein festigen sollen.“ (107). Auf die verdeckt religiöse Dimension der Politik weist der Autor im Folgenden hin, bevor er das politische „Märtyrerverständnis des europäischen Nationalismus“ behandelt (111-118). In einem Unterkapitel wird dann – etwas unerwartet – auch der islamische Nationalismus thematisiert. Hier wird differenziert zwischen dem arabischen islamischen Nationalismus, der keinen Personenkult kenne, und dem türkischen Nationalismus, der mit seinem Personenkult auf vorislamische Zeiten zurückgreift. Wohl kennt die schiitische Richtung des Islam einen Personenkult, der auch in der Islamischen Republik Iran zum Tragen kommt. (118-126). Es folgt die Analyse des politischen Martyriumsverständnisses im Bolschewismus (126-132) und Nationalsozialismus (132-137). Die aus der Analyse erstellten fünf Kriterien werden ausführlicher als vorher beschrieben (137-139). Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Politische Märtyrer des europäischen Nationalismus besitzen keinen universalen sondern nur einen rein nationalen Charakter, „ihr Blut bildet eine Art mystische Substanz, aus der das Volk wiedergeboren werden soll.“
- Politische Märtyrer lassen sich als eine Art „Sühneopfer“ verstehen, vor allem wenn die Gemeinschaft sich von den Traditionen entfernt hat. Durch sie geschieht eine Art Wiedergeburt der Nation.
- Politische Märtyrer des europäischen Nationalismus schaffen eine Vorstellung von einer Blutgemeinschaft, zu der andere keinen Zugang haben.
- Der arabische Nationalismus hat, im Gegensatz zum europäischen und türkischen, nicht auf die heidnische Zeit zurückgegriffen. Dies ist nach dem Autor wohl der wichtigste Grund dafür, dass sich der arabische Nationalismus in Richtung Fundamentalismus entwickelte.
- Religion wird auf der Grundlage völkischen Gedankenguts interpretiert und der universelle Charakter der Gottebenbildlichkeit weginterpretiert. Das Heil ist partikular und nicht mehr universal.
Auf den folgenden sechs Seiten (141-146) vergleicht der Autor das christliche, islamische und politische Martyrium. In den abrahamitischen Religionen ist das Martyrium als Zeugnis ablegen für Gott der höchste Liebesbeweis. An Märtyrer können sich die Gläubigen ausrichten. Das Martyrium im Christentum unterscheidet sich in einem Punkt wesentlich von dem islamischen und dem jüdischen: es ist die Nachfolge, Imitation des Martyriums des Gottmenschen. Der Autor nennt die christlichen Märtyrer Tatzeugen, die jüdischen und muslimischen Märtyrer sind Wortzeugen, da sie das in der Schrift festgehaltene Wort bezeugen. In den jüdischen und islamischen Martyrien werden die Henker verdammt, während in der christlichen Tradition für die Henker gebetet wird. Zudem verbietet das christliche Martyrium jegliche Gewalt. In allen drei Traditionen soll, wenn möglich, dem Martyrium entflohen werden.
Im Gegensatz dazu lassen die politischen Märtyrer ihr Leben stellvertretend für das Volk. Sie sollen das völkische Bewusstsein wecken. Grundlage ist, dass sich ein Volk als auserwählt betrachtet. So können die anderen Völker dämonisiert werden.
Auf den Seiten 147-167 stellt der Autor die mimetische Theorie von René Girard dar. Dann betrachtet er erneut das Martyrium im Christentum, im Islam sowie im Nationalismus, Bolschewismus und Nationalsozialismus aus der Sicht der Mimetischen Theorie (167-194). Es folgen eine Zusammenfassung (195-199), ein Literaturverzeichnis (201-216) und ein Personenregister (217-219).
Das Werk behandelt ein gerade in heutiger Zeit wieder virulent gewordene Frage nach den Märtyrer. Aus den Medien bekannt sind die vielen Märtyrer im Islam, die durch Selbstmordanschläge umgekommen sind, als Täter wie auch als Opfer. Aber auch im Christentum wird verstärkt die Verfolgung von Christen betont, die auch in einem Martyrium enden kann. In einer solchen Situation ist es wichtig, klare Kriterien zu haben, um einer Inflation des Gebrauchs des Märtyrerbegriffs vorzubeugen. Die vergleichende Untersuchung kommt somit zur rechten Zeit.
Die mimetische Theorie ist dabei hilfreich, die Gewaltdimension bei den unterschiedlichen Märtyrerbegriffen zu beleuchten. So können deutliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden, vor allem auch im Hinblick auf die Bedeutung des Martyriums für die Gesellschaft. Es ist nicht überraschend, dass sich bei der Analyse der Martyrien in den verschiedenen Religionen und Pseudo-Religionen mit Hilfe der mimetischen Theorie das christliche als die Vollendung der Gewaltfreiheit herausstellt.
Dem Werk fehlt ein strenger logischer Aufbau. Inhaltlich kommt es immer wieder zu Wiederholungen und die Gedanken werden in konzentrischen Kreisen weiter entwickelt. Die Auswahl der Martyrien für die Analyse ist nicht begründet und erscheint eher zufällig. Ein weiteres Manko ist das Fehlen der französischsprachigen Literatur. Gerade in der französischsprachigen Theologie und Philosophie sind viele Werke zu René Girards mimetischer Theorie erschienen.
Insgesamt ist die Arbeit lesenswert, auch für den Nicht-Fachmann.
Jan 17 2013
Fadi Daou, L’inculturation dans le « Croissant ». Les Églises orientales catholiques dans la perspective d’une Église arabe.
Fadi Daou, L’inculturation dans le « Croissant ». Les Églises orientales catholiques dans la perspective d’une Église arabe. (Thèse pour obtenir le grade de Doctorat : Nouveau régime. Discipline : Théologie catholique, Université Strasbourg II – Marc Bloch. Faculté de Théologie catholique) septembre 2002 (2 Bde.) 883 S.
Fadi Daou, maronitischer Priester aus dem Libanon, hat 2002 seine Doktorarbeit über die Inkulturation der Kirche im arabischen Halbmond veröffentlicht. Der Untertitel weist darauf hin, dass er sich im näheren mit den katholischen orientalischen Kirchen befasst, und zwar unter der Perspektive einer arabischen Kirche. Er greift damit eine programmatische Schrift von Jean Corbon „L’église des arabes“ (1977) auf. Es geht dem Autor um die Erstellung einer Struktur für eine Erneuerung durch Inkulturation in den orientalischen katholischen Kirchen des arabischen Halbmonds. Dafür hat er drei theologische und ekklesiologische Kategorien mit Inkulturation konjugiert: Mission, Kommunion und Katholizität. Am Ende dieses Prozesses sieht er eine arabische Kirche, die die Traditionen der verschiedenen katholischen orientalischen Kirchen bewahrt und sich auf die Herausforderungen der Gegenwart einlässt.
Nach einer Einleitung (5-14) gliedert er die umfangreiche Arbeit in drei Abschnitte: Im ersten Teil beschreibt er die Geschichte der Inkulturation der orientalischen katholischen Kirchen (16-247). Das erste Kapitel widmet er der Entstehung der verschiedenen orientalischen Kirchen als einen Inkulturationsprozess. (19-79). Eingeleitet wird dieses Kapitel mit einer Problematisierung der Begriffe „Christlicher Orient“ und „orientalisches Christentum“ (20-27). In der Darstellung der Geschichte der Kirchen in dieser Region sieht er von Anfang an eine Vielfalt an Kulturen, was berechtigterweise zu einer Vielfalt an Kirchen geführt hat. Trotz dieser Vielfalt sieht Daou keine Gefährdung der Kircheneinheit in den ersten Jahrhunderten, da die verschiedenen theologischen Konzepte zwischen den verschiedenen Kirchen zirkulierten und die Kirchen sich gegenseitig bereicherten. Erst der Aufstieg Konstantinopels am Ende des 4. Jahrhunderts stellte seiner Meinung nach die Einheit in Frage. Nach einer zusammenfassenden Darstellung der Geschichte der Häresien und Schismen kommt er auf die aktuellen christologischen Erklärungen der Kirchen, die die dogmatischen Gründe der Teilung als überholt erweisen. Mit Bouwen fragt er, ob die lange Zeit der Trennung angesichts dieser Erklärungen umsonst war (71). Er sieht aber nicht dogmatische Gründe, sondern übertriebenes Nationalbewusstsein und byzantinisches Hegemonialstreben als die Hauptursache der Trennung. Er geht schließlich auf die Kriterien für eine neue Annäherung der Dogmen ein: das erste Kriterium ist eine breitere Perspektive auf die Mission. Der Glaube muss angesichts der heutigen Probleme interpretiert werden. Das zweite Kriterium ist die apophatische Theologie. Das Geheimnis ist so groß, dass eine Vielzahl der Ausdrucksweisen legitim ist. Das dritte Kriterium bildet für ihn der Grundsatz lex orandi – lex credendi. (72-74).
Im zweiten Kapitel beschreibt er die Entwicklung des Verhältnisses der katholischen orientalischen Kirchen zu Rom (80-153). Er fragt, ob es ein Jahrtausend der Dekulturation war. In dem ersten Abschnitt betrachtet er das Paar Rom / Byzanz und die Geburt der Orthodoxie (81-107). Laut Daou bilden die kulturellen Unterschiede eine wichtige Grundlage für den Konflikt. Der Bruch zwischen Rom und Byzanz fand tatsächlich entlang der Sprachgrenze statt (82-84). Im zweiten Abschnitt stellt er die These auf, dass das Fehlen einer kohärenten Ekklesiologie, die von allen akzeptiert ist, im Zentrum des Problems der Trennung von Rom und Byzanz, wie auch des Problems mit anderen Kirchen steht. In den ersten drei Jahrhunderten sei die Kirche eine Bruderschaft lokaler Kirchen gewesen (90). Nach Daou bietet das Patriarchat Antiochien mit all seinen Zweigen die Chance, der traditionellen Lesart der Spaltung Byzanz-Rom zu entrinnen. Er sieht zwei Phasen: in der ersten gruppieren sich die verschiedenen Gemeinschaften zu einem Patriarchat. In der zweiten Phase erfolgt die Rückkehr zur jeweils eigenen Existenz der verschiedenen Gemeinschaften im selben Patriarchat. Im reifen Alter entstehen so die syrisch-orientalische, die westsyrische und die maronitische Kirche. Die Melkiten haben dabei einen besonderen Weg genommen (92-94). Im folgenden zweigt er die imperialistischen Tendenzen der byzantinischen, und die zentralistischen der römischen Ekklesiologie. Im zweiten Abschnitt fasst er die Geschichte der Latinisierungs- und die Zentralisierungstendenzen der römischen Kirche zusammen (108-134). Im dritten Abschnitt geht er auf neuere Entwicklungen seit Papst Leo XIII. ein (135-153). Er sieht hier die Entstehung eines neuen Verständnisses von Katholizität.
Im dritten Kapitel beschreibt er das Dilemma der Inkulturation in der arabisch-muslimischen Welt ( 154-247). Nach der Darstellung der Geschichte der christlichen Araber vor dem Islam (156-164) folgt dann die Darstellung der Christen zur Zeit Muhammads und der muslimischen Eroberung (164-172). Im folgenden Abschnitt über die Erneuerung durch Inkulturation (172-185) stellt er zunächst die Ambiguität des Begriffs der arabo-islamischen Welt fest. Seiner Darstellung nach haben die orientalischen Christen eine neutrale Position bei den Auseinandersetzungen zwischen Byzanz und Muslimen eingenommen und so konnten sich die Eroberer auf die autochtone Bevölkerung stützen ( 176-177). Es folgt die traditionelle Darstellung der Ursprünge der maronitischen Kirchen (178-179). Im zweiten Abschnitt geht er den Herausforderungen der Christen unter dem Islam nach (186-216). Der Status des dhimmi macht die Kirchen zu Gefangenen des muslimischen Staatssystems (187-193). Der westliche Protektionismus (Stichwort: Kapitulationen) stellte für die Christen eine gefährliche Versuchung dar (193-205). Schließlich werden die neuzeitlichen Massaker und die Zerstreuung der orientalischen Christen dargestellt (193-216). Der dritte Abschnitt befasst sich mit den Hoffnungen und Illusionen im gegenwärtigen Nahen Osten (217-242). Als große Hoffnung galt die Nahda-Bewegung, die eine Gleichstellung der Christen zu versprechen schien (218-226). Der Zerfall der „arabischen Nation“ und der Aufstieg des Islamismus zerstörten die Hoffnungen (230-242).
Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Teils sind für den Autor, dass die Verbindung zwischen Kultur und christlichem Glauben bei den orientalischen Kirchen ohne Akkulturation vonstatten gegangen ist, da der Glaube hier geboren wurde. Er bezeichnet den Vorgang als Auto-Evangelisierung, da das Volk die Botschaft mit den eigenen kulturellen Mitteln empfängt. Inkulturation ist dabei das gemeinsame Werk der christlichen Gemeinschaft und kein Werk von Spezialisten (243). Die Pluralität doktrinaler und struktureller Art im orientalischen Christentum ist eine natürliche Konsequenz einer gelungenen Inkulturation in einer multikulturellen Welt. Dies ist der Kontext der Entstehung der Einzelkirchen. Dabei ist niemals die Inkulturation Ursache der Kirchenspaltungen gewesen (244). Diese sind nicht durch die Pluralität, sondern durch die Exklusivität und die Homogenität einer Gruppe verursacht worden (245). Die Herausforderung der orientalischen katholischen Kirchen ist nicht nur die Rückkehr zu den Quellen, sondern auch die Eingliederung in die andere Welt. „Wie kann das doppelte Risiko der Marginalisierung eines In-sich-Verschließens und das der Auflösung in eine Assimilation oder der Rückweisung durch den anderen umgangen werden?“ Er sieht in der Auf-sich-selbst-Bezogenheit, die durch die dhimmitude oder millal sanktioniert ist, den schlechtesten Zustand der Kirche (246).
Der zweite Teil „Die Inkulturation in dem globalisierten arabischen Halbmond gründen“ (252-557) behandelt zunächst den Inkulturationsgedanken und die Kultur als solche, um die Erkenntnisse dann auf den Nahen Osten anzuwenden. Das erste Kapitel stellt deshalb die Entstehung des Inkulturationsgedankens vor (257-297). Diese teilt er in drei Phasen, nämlich von der Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils bis in die Mitte der 70er Jahre, von der Bischofssynode zur Evangelisierung 1975 bis zum Ende der 80er Jahre, und seit der Publikation von Redemptoris missio. Im zweiten Kapitel versucht der Autor eine neue Annäherung an das Inkulturationskonzept, nämlich als Theo-praxeo-logie (298-331). Hierbei distanziert er sich von der Inkulturation als Missionskonzept, stellt es in das Zentrum des Glaubensvollzugs (298) und geht auf Distanz zu dem Konzept der bloßen Beziehung des christlichen Glaubens zu den Kulturen. Dabei will er das Inkulturationskonzept in die Mitte des fundamentaltheologischen Diskurses stellen. „Wir glauben tatsächlich, dass universelle Präsenz und Aktion des Wortes und des Geistes aus der menschlichen Geschichte eine Erzählung Gottes macht oder besser eine Erzählung der Vergöttlichung des Menschen“ (319). Theo-praxeo-logie bedeutet zu zeigen, dass die Gesamtheit der Geschichte diejenige des Liebesbundes Gottes mit der Menschheit ist. Inkulturation ist eine diskursive Realität (logos) über die Beziehung zwischen Glauben und den Kulturen, genauso und untrennbar damit ist sie eine Aktion (praxis), die aus der menschlichen Aktivität des Kulturschaffens entsteht. Gleichzeitig ist es eine Theologie, ein Diskurs über die göttlichen Aktivitäten in der Welt im Rahmen der Heilsgeschichte (320). Der Heilige Geist stellt dabei den gemeinsamen Raum der Begegnung zwischen Gott und den Menschen dar und ist erster Agent jeder Inkulturation, die einen menschlichen Reifungsprozess in der göttlichen Pädagogik entspricht (324). Inkulturation kann so nicht mehr als pastorale Strategie oder als missionarische Haltung angesehen werden, sondern muss als Teil einer Haltung des Empfangs und des Hörens auf die Aktion des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes verstanden werden, die jedem Missionar und Theologen auf den verschiedenen Wegen der Menschheit vorausgehen (328). Im dritten Kapitel (332-375) stellt er die aktuellen Herausforderungen der Inkulturation dar (332-375). Drei Aspekte behandelt er dabei: die lokale Kirche, den interreligiösen Dialog und die missio Dei , missiones ecclesiae. Die plantatio ecclesiae ist für ihn zunächst nicht die Installation einer Hierarchie und einer kirchlichen Struktur, sondern die Inkarnation der Kirche als mystischer Leib Christi in dem Fleisch einer konkreten Menschheit (334). In diesem Kapitel entwickelt Daou sein Verständnis der drei Arten, die missio Dei zu offenbaren: die Verkündigung, der Dialog und das Zeugnis. Im fünften Kapitel entwickelt er ein Konzept der Kulturen, die er mit vielen anderen Autoren in einer Krise sieht (376-461). Die wichtigsten Kennzeichen sind dabei die Säkularität und die Plurikulturalität. In einem dritten Abschnitt behandelt er die kulturellen Herausforderungen heute. Schlüsselbegriffe sind dabei Solidarität und „Bien-vivre-ensemble“ (428-461).
Das sechste Kapitel steht unter der Überschrift „Des-Orientierung des Mittleren Ostens und die schwierige Geburt eines „arabischen Halbmonds“ (462-559). Dabei stellt er zunächst die Identitätskrise des Arabertums dar und zieht den Schluss, dass sich früher die Araber auf das Prinzip der Selbsterhaltung angesichts des anderen stützten, heute aber ihre einzige Chance darin liege, das „bien-vivre-ensemble“ auszuarbeiten (462-492). Des Weiteren stellt er die problematische Beziehung zwischen den arabischen Gesellschaften und den Prinzipien des Bürgertums, der Demokratie und der Menschenrechte dar. Das Kapitel beschreibt er mit einer Aufstellung der Religionsgemeinschaften, insbesondere der christlichen in der Region (524-556).
Der dritte Teil unter der Überschrift „Die Orientalischen Katholischen Kirchen in der Perspektive einer arabischen Kirche oder die neue Inkulturation“ ist der Kernbereich seiner These (565-794). Die Inkulturation der orientalischen katholischen Kirchen sieht er durch die Apostolizität, die Einheit und die Katholizität bestimmt (566). Es ergeben sich vier Achsen des kirchlichen Lebens und der Erneuerung durch Inkulturation: 1. Lösungen müssen den konkreten Menschen des 21. Jahrhunderts gerecht werden und nicht der westlichen Welt. 2. Kirche ist solidarisch mit den Zivilgesellschaften und Partner anderer Gruppen des „bien-vivre-ensemble“. 3. Dies stellt der Kirche die Frage, ob sie für die Verteidigung ihrer Gläubigen da ist oder im Dienst des anderen und des Gemeinwohls steht. 4. Die Erneuerung verlangt andere Beziehungen unter den katholischen Kirchen und in der Ökumene (568). Da es vor seiner These noch keine theologische Arbeit zur Inkulturation im Nahen Osten gab, entwickelt er seine Arbeit auf der Grundlage der Pastoralbriefe der katholischen Patriarchen im Orient. Sie werden unter Rückgriff auf die vorhergehenden einleitenden Untersuchungen analysiert, um eine Struktur für eine Erneuerung der orientalischen katholischen Kirchen des arabischen Halbmonds durch Inkulturation zu entwickeln. Aus den kritischen Anmerkungen ergibt sich die Position von Fadi Daou.
Das siebte Kapitel behandelt die Inkulturation und Mission anhand des Pastoralbriefes « Ensemble devant Dieu » (570-661). Mission und Apostolizität sind für ihn gleichgesetzt.
In diesem Kapitel untersucht er, wie weit die katholischen Kirchen im Orient der Frage der Mission nachgehen. Nach der Beschreibung, wie die katholischen Patriarchen die heutige Zeit sehen, geht er der Frage nach der missionarischen Berufung der katholischen Kirchen im Nahen Osten nach. Er verweist darauf, dass die Patriarchen beim ersten Treffen die Mission der Kirche in der Region als essentielle Aufgabe wiederentdeckt haben. Dabei zähle nicht die Anzahl der Christen, sondern was die Kirchen der Welt an Besonderem anbieten (572). Die Berufung aller Kirchen und Orden in der Region sei es, die Präsenz Christi für die Brüder zu sein, die auf dem Weg des Islam zu Gott sind (580). In einem weiteren Schritt beleuchtet er die neue Inkulturation vor dem Hintergrund der Tradition, um schließlich die verschiedenen Dimensionen der Mission zu beleuchten. Unter Berufung auf die Exhortation „Une espérance nouvelle pour le Liban“ schreibt er, dass die Kirchen sich in die authentische Tradition stellen müssen, um die Früchte für das Leben heute zu ernten (586). Dabei gelte es, das gemeinsame Erbe von sieben Kirchen Antiochiens zu fruchtbar zu machen (587).
Im zweiten Teil (603-623) beleuchtet er die interreligiöse, intrakulturelle Begegnung. Arabische Christen und arabische Muslime teilen dieselbe Kultur. Das ist das Besondere an dieser Begegnung. Die kulturelle Rolle der Christen wird unter dem Gesichtspunkt der Theo-praxeo-logie beleuchtet und gefragt, wie die arabische Kultur zu einer „größeren Freiheit befreit“ werden kann. Daou legt weniger Wert auf den akademischen Dialog. Unter Berufung auf den 3. Pastoralbrief sieht er in der Präsenz des Anderen die Stimme Gottes in unserem Leben. Deshalb wird im Dialog der andere in der Fülle seiner Persönlichkeit anerkannt und als die Vollendung seiner selbst empfangen. Das wichtigste Resultat des islamisch-christlichen Dialogs in dieser spirituellen Dynamik seien weder die Kenntnis der anderen Religion, noch die Konversion zur anderen Religion, sondern die Konversion jedes Akteurs zu Gott und der Eintritt in eine spirituelle Solidarität, die die Beziehungen auf dem täglichen Niveau reinigt und festigt (608). Eine praktische Dimension kommt hinzu: Gemeinsam vor Gott zu stehen bedeutet auch, gemeinsam für das Gemeinwohl zu arbeiten (609). Der dritte Teil (624-661) fragt nach dem Dienst der Kirche an Mensch und Gesellschaft. Zunächst beschreibt er die Notwendigkeit der Dekonfessionalisierung. Der Kommunitarismus stellt das größte Problem für das bürgerliche Engagement dar. Daou meint, dass der Konfessionalismus zu einem oberflächlichen Glauben führt, nämlich zu Fideismus und Kleriko-Institutionalismus. Glaube wird so innerlich geleert und auf soziales und rituelles Engagement reduziert. Oder aber – um diesem zu entfliehen – werde ein Glaube nach neuen Formen praktiziert, der durch Sentimentalität und populäre Euphorie geprägt ist (627). Er erkennt aber auch Zeichen der Hoffnung: die Existenz vieler katechetischer Zentren, die den Glauben in den Kontext der Zeit setzen, und das Wiedererwachen des missionarischen Gedankens (631). Doch er sieht auch Zaudern und Rückschritte auf dem Weg der Überwindung des Konfessionalismus: Im 3. Pastoralbrief steht einerseits die Forderung nach der Bildung eines verantwortlichen Bürgers, andererseits die Position der Politik des Kommunitarismus (633-634). Im 4. Pastoralbrief schließlich sehen die Bischöfe die Schuld beim Staat, der keine klare Position zu der Vielfalt der Religionen bezieht und deren Beteiligung an der Macht (634). Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren (vor 2003) der Kommunitarismus verstärkt (636). Daou glaubt nicht, dass die Zukunft in einer besseren Teilhabe der Kommunitäten am Staat liegt, sondern das politische Engagement auf der Basis der Konfessionen langfristig schadet. Eine Dekonfessionalisierung bleibe notwendig, auch wenn strukturelle Unsicherheiten auf nationalem Niveau fortbestehen (638). Auch der Umgang der orientalischen Katholiken mit der Armut sei problematisch (640-646). Gott offenbare sich zwar im armen Mitmenschen, allerdings konnte dies nicht zu einer Befreiungstheologie führen wie in Lateinamerika. Schließlich kommt der Autor auch auf die Friedensmission der Kirchen zu sprechen und stellt zurecht fest, dass das Augenmerk in den offiziellen Dokumenten auf der israelisch-arabischen Auseinandersetzung liegt (646-661).
Das achte Kapitel betrachtet die Inkulturation unter dem Aspekt der Kommunion (662-713). Im ersten Abschnitt behandelt er die spannungsgeladene Kommunion der katholischen orientalischen Kirchen (663-680). Der Autor weist darauf hin, dass nach dem Konzilsdekret Orientalium Ecclesiarum 30 die katholischen orientalischen Kirchen eine provisorische Einrichtung bis zur vollen Kommunion mit den anderen Kirchen ist (664) und dass nach der Deklaration von Balamand dem Uniatismus abgesagt wurde und die Schwesternkirchen „neu entdeckt“ wurden. Dies veranlasst ihn zu fragen, was dann die Rolle der katholischen Orientkirchen sei (666). Der Autor glaubt, dass die Ambiguität in den römischen ekklesiologischen Deklarationen für die katholischen orientalischen Kirchen schlimmer sei als die tatsächliche Situation selbst (669-671). Am Beispiel der Apostolischen Kirche des Ostens und der chaldäischen Kirche zeigt er die Chancen einer Kommunion „von unten“. Er konnte den späteren Rückschlag nicht voraussehen, der durch den Übertritt von Mar Bawai Soro, dem assyrischen Bischofs der Western Diocese of California, zur katholischen Kirche verursacht wurde. Die melkitisch-griechisch-orthodoxen Einigungsbemühungen sind für ihn Beispiel eines gescheiterten Versuchs. Er erklärt auch die Gründe des Scheiterns: es fehlte vor allem der Geist der Einigung. Die Zeit sei noch nicht reif gewesen. Es wurde zu sehr von der kanonistischen Seite her gedacht. Im Pastoralen war die Differenz noch zu groß (671-679). Im zweiten Abschnitt geht er auf die Struktur und die Arbeit des Nahöstlichen Rates der Kirchen ein (681-686). Das größte Defizit in der Arbeit des Rates sieht Daou darin, dass zu viel in den Einzelkirchen geschieht und zu wenig gemeinsam (682).
Der dritte Abschnitt behandelt die Auswirkungen einer neuen Inkulturation auf die Kommunion (687-713). Die Suche nach der neuen Einheit gestaltet sich in der Pastoral – so Daou – durch einen immer größeren Platz von MECC in den regionalen Fragen des Dialogs, der Gerechtigkeit, des Friedens und der Versöhnung und in einer Reinigung jeder Kirche von allem, was der Einheit im Wege steht. Dies erfordere vor allem eine Konversion der Mentalitäten (692). Die Zusammenarbeit sei dabei der Weg zur Einheit und Ökumene der Nähe (692-694). Daou macht zwei konkrete Vorschläge für den Weg zur Einheit: Der erste Vorschlag betrifft das monastische Leben: dasselbe Gebet teilen, dasselbe Zeugnis des radikalen Engagements und das Gemeinschaftsleben teilen, trotz unterschiedlicher Kirchenzugehörigkeit (710). Der zweite Vorschlag beinhaltet, dass die ökumenische Idee in den Gemeinden und in der Priesterausbildung kommuniziert werden müsse und der dritte Vorschlag betrifft das gemeinsame Gebet und das Gebet für einander, ohne dass dies ausdrücklich ökumenisch orientiert sein müsse – es sei quasi normal (711).
Das neunte und letzte Kapitel handelt von der Inkulturation und der Katholizität (715- 794). Im ersten Abschnitt vertritt Daou die Meinung, dass die römische Ekklesiologie der zwei Etagen, namentlich die Diözese und die Universalkirche, nicht ausreiche, um die Katholizität zu sichern. Dies könne nur die synodale Kirche (mit den Patriarchaten) sichern, da hier besser Einheit und Verschiedenheit abgebildet werden könne (715-738). Im zweiten Abschnitt stellt er die Problematik der Diasporakirchen im Westen dar (739-768). Der dritte Abschnitt behandelt die katholischen orientalischen Kirchen sui iuris in der Perspektive einer lokalen arabischen Kirche (769-794). Daou leitet diesen Abschnitt mit zwei Fragen ein: Ist es heute noch gerechtfertigt, dass es sechs verschiedene katholische Bischöfe in Beirut gibt, und jeweils fünf in Kairo und Aleppo? Warum müssen in einem Dorf mit mehreren Hundert Einwohnern, wo die Leute das gleiche soziale und kulturelle Leben teilen, an zwei oder drei verschiedenen Orten der katholische Glaube gefeiert werden? (771) Er beantwortet die Frage dahin gehend, dass heutzutage nicht nur mehr Koordination gefragt sei, sondern eine neue Inkulturation. Weder ökumenische Rücksichten (Patriarchate), noch das Misstrauen gegenüber einer Latinisierung rechtfertigen die Fortsetzung traditioneller kirchlicher Strukturen, wo die Gesellschaft gerade einen fundamentalen Bruch in ihrem kulturellen Sein erlebt. Die Strukturen der Ökumene wegen aufrecht zu halten, bedeute eine institutionelle Einheit, sie riskiere damit aber die kirchliche Leere, ja die Abwesenheit der Gläubigen (774). Daou fragt, ob sich die gelebte und erfahrene Einheit auf der hierarchischen Ebene auf das liturgische Leben der Gemeinden herunterbrechen lässt. Die Patriarchen, so stellt er fest, schweigen dazu. Ist es aber konsequent zu sagen, dass der Glaube gemeinsam gelebt werden soll, aber nicht im Moment der Darbringung dieses Glaubens? Er beantwortet sie auf den folgenden Seiten: Die katholischen Patriarchen bestehen zurecht auf der notwendigen Konversion ihrer orientalischen Kirchen, um aus dem konfessionellen Schema, das sie gefangenhält, zu entfliehen. Dies kann nach Daou durch eine Umkehr der Perspektive geschehen: von kommunitaristischer Abschottung hin zu einer missionarischen Öffnung auf die Welt (793),
Im Schlussteil (795-799) macht Daou auf drei Ebenen konkrete Vorschläge: dem soziopolitischen, dem ökumenischen und dem katholischen Niveau. Es folgt die Bibliographie, die die Werke nach verschiedenen Kategorien ordnet (800-835). Im Anhang befinden sich Karten, Tafeln und Texte (837-855). Das Werk schließt mit Indices, Sigelverzeichnis und Inhaltsverzeichnis (857-883).
Bewertung
Es handelt sich hier um eine typische Doktorarbeit an einer französischen Universität. Sie ist sehr umfangreich und die ersten beiden Teile dienen zur Vorbereitung der These, die dann im dritten Kapitel entwickelt wird. Die ersten beiden Teile umfassen zwei Drittel des Umfangs der These. Im ersten werden die Geschichte der orientalischen Kirchen und bestimmte Schwerpunktsetzungen zusammengefasst, im zweiten der Begriff der Inkulturation und die Vorstellung von der arabischen Kultur problematisiert. In diesen weit ausgreifenden Zusammenfassungen und Hinführungen zum Thema kann der Autor nicht alle verfügbare Literatur und Forschungsergebnisse berücksichtigen, sondern muss sich auf allgemein rezipierte Literatur beschränken. So passiert es leicht, dass traditionelle Ansichten wiedergegeben werden, aber neue Erkenntnisse nicht zur Sprache kommen, wie zum Beispiel die Wiedergabe des traditionellen maronitischen Geschichtsbildes oder die Vorstellung, dass die orientalischen Christen aus Abneigung gegenüber Byzanz die Araber als Befreier empfangen oder sich neutral verhalten haben. Im dritten Teil gibt es einen historischen Irrtum. Der Autor geht davon aus, dass die Apostolische Kirche des Ostens Mitglied des MECC geworden sei. Tatsächlich stand der MECC kurz vor der Aufnahme dieser Kirche, jedoch wurde der Schritt nicht vollzogen.
Leser, die die Grundzüge der orientalischen Kirchengeschichte und die Diskussionen zur Inkulturation kennen, werden in den ersten beiden Teilen kaum etwas Neues erfahren. Jedoch können sie auch nicht einfach überschlagen werden, da immer wieder zentrale Ideen entwickelt werden. So behandelt er im zweiten Abschnitt seine Vorstellungen von der Inkulturation als „Theo-Praxeo-logie“, einem zentralen Begriff, der in dem letzten Abschnitt wiederholt vorkommt.
Für den Leser, der durch den Titel des Werkes neugierig wurde, ist der dritte Teil der interessanteste. Es stellt sich die Frage, warum sich der christliche Glaube im Orient inkulturieren soll, wo er doch in dieser Kultur selbst entstanden ist. Tatsächlich geht es hier nicht darum, dass der Glaube in eine andere Kultur übersetzt werden muss, sondern dass er sich der gewandelten Kultur und den neuen Realitäten anpassen muss. Vielleicht wäre hier der Begriff der Kontextualisierung angebrachter gewesen als der der Inkulturation. Diese Inkulturation, verstanden als Kontextualisierung oder Erneuerung, ist eine permanente Aufgabe der Kirche, wie der Autor dies auch darstellt. Hierfür entwickelt er den Begriff der „Theo-praxeo-logie“. Grundlegende theologische Gedanken, wie die, dass die gesamte Schöpfung, einschließlich der Kultur und Religion, Werk Gottes ist und die Geschichte durchgehend eine Geschichte der Begegnung von Gott und Mensch ist, sind wichtige Aspekte, die für den interreligiösen Dialog fruchtbar gemacht werden können.
Die Grundlage seiner Arbeit über die Inkulturation im arabischen Raum bilden die Pastoralbriefe der katholischen Patriarchen. Der Autor beschränkt sich auf die Inkulturationsproblematik der katholischen orientalischen Kirchen. Durch Würdigung und Kritik arbeitet er die Herausforderungen und die notwendigen Schritte für eine „neue Inkulturation“ heraus. Damit kann er sich bei seinen Thesen auf kirchliche Dokumente stützen, wenn er seine im orientalischen Kontext provozierenden Thesen aufstellt. Hierzu gehört die Ansicht, dass die Konzentration auf die eigene Tradition und Gemeinde, der Konfessionalismus und Kommunitarismus die Grundübel seien und eine neue Inkulturation und damit Zukunftsfähigkeit des katholischen Glaubens in der Region, sowie das Ziel der Einheit als eine arabische „Kirche der Kirchen“ behindere (662).
Neben kleineren Fehlern oder mangelnder Rezeption neuerer Ergebnisse ist die verwendete Literatur ein Schwachpunkt. Sie ist fast ausschließlich französisch mit einem kleineren Anteil arabischer Literatur. Wenige englischsprachige Werke wurden verwendet. Die übrige internationale Literatur zur Inkulturation, arabischen Kultur und orientalischen Kirchengeschichte wurde nicht rezipiert und so herrschen in dem Werk französische Ideen vor. Dass nur relativ wenig arabische Literatur verwendet wurde, spiegelt die Problematik der Wissenschaft und insbesondere der Theologie wider. Gewichtige Literatur wird in erster Linie in Französisch oder Englisch verfasst. Überhaupt ist die Produktion von wissenschaftlicher Literatur in den orientalischen Kirchen nur relativ schwach entwickelt.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der dritte Teil ist unbedingt lesenswert für alle, die sich theologisch mit der Lage der katholischen Kirche(n) im Orient befassen wollen und die Vision einer lebendigen Kirche jenseits der Traditionsbewahrung suchen.
Nov 24 2012
(English) Church and Catholicism since 1945 in the Near East and North Africa
Harald Suermann (Hg.), Naher Osten und Nordafrika = Erwin Gatz (Hg.), Kirche und Katholizismus seit 1945, Paderborn, 2010, XX, 255 S.; ISBN: 978-3-506-74465-4
This volume presents the development of the various Catholic churches in the Middle East and North Africa since the collapse of the Ottoman Empire until today. In the Maghreb countries, where there is practically only the Roman Catholic tradition, particular attention is given to the transition of the church from the colonial power to the churches of the independent states.
As regards the various Catholic churches in the Middle East – Coptic Catholic, Armenian Catholic, Syrian Catholic, Greek Catholic, Chaldean, Maronite and Latin (Roman) – the diversity of traditions and history of multiple branches are represented. Items of each country (Turkey, Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, Holy Land, Egypt, North Africa, the Arabian Peninsula ) portray the history of each of the churches. Emigration and immigration are treated as well as inter-religious and ecumenical dialogue. Institutions such as the episcopal conferences and caritas are subject, as well as Catholic schools and the relationship between church and state . Refugees find a place as well as the sociological profile of Christians.
The churches of the Arabian Peninsula formed mainly of migrant workers in the West and Asia are also described.
Contents
Foreword V
Table of Contents VII
List of abbreviations XV
Glossary XVII
CHAPTER 1: Introduction
By Harald Suermann 1
1. The general situation in the Middle East and North Africa 1
2. The individual churches 2
3. History of Christians in Islamic countries 8
4. The common institutions and ecumenism 10
4.1. Middle East Concil of Churches 12
4.2 . The Catholic-Orthodox dialogue 15
4.3. Oriental Churches and the Latin Church 18
a) the first phase 19
b) The second phase 20
c ) The third phase 20
4.4. The Catholic-Assyrian dialogue 22
5. The common Catholic institutions 27
5.1. Council of the Catholic Patriarchs of the Orient 27
5.2 . CELRA and C. E. R. N. A. 29
5.3 . Special meetings of the Synod of Bishops 30
6. Inter-religious dialogue 30
7. Migration 32
CHAPTER 2: Turkey
By Herman Teule 35
1. The inter-war period 36
2. The ecclesiastical structure in the postwar period 38
2.1. Emigration and related developments 40
2.2. The Chaldean Church 40
2.3. The Syrian Catholic and Syrian Orthodox churches 42
2.4. The Gregorian ( Orthodox ) Armenian and Armenian Catholics 43
2.5. The Greek Orthodoxes and the Greek Catholics 44
3. Inculturation 46
4. Ecumenism 48
5. Dialogue with Islam – Position of Christian minorities 49
6. Contacts with the authorities and legal status of churches 50
7. Conclusion 51
CHAPTER 3: Iraq
By Harald Suermann 53
1. The churches and their origins in Iraq 53
2. Churches in particular 54
2.1. The Catholic Particular Churches 54
2.2 . The non-Catholic churches 56
-
Ottoman Empire – Independence (1932) – Hashemite monarchy (1921-1958) 57
3.1. Mandate 58
3.2. The Hashemite monarchy 59
3.3. The Republic of 1958-1968 60
4. From 1968 up to the First Gulf War 63
5. From the Second to the Third Gulf War (1990-2003) 68
6. Third Gulf War 72
6.1. Criticism of the Christians and their position before the Third Gulf War 72
6.2 . The invasion and occupation of Iraq 74
7. The post-war period 75
7.1. The Christians and the new Constitution 76
7.2 . The Iraqi interim constitution 77
7.3. The elections of January 30th, 2005 77
7.4. The new constitution 78
7.5. The general situation of Christians 80
7.6. The situaltion in the south 84
7.7. The situation in the north 84
CHAPTER 4 : Syria
By Herman Teule 87
1. Introduction 87
2. Inter-war period 88
2.1. Nationalism 88
2.2. The Christian population on the eve of independence 89
3. The Catholic communities after independence 91
3.1. The organization 91
3.2 . Ecumenism 94
3.3. Second Vatican Ecumenical Council 98
3.4. Relations with Islam 99
3.5. The school question 100
3.6. Emigration and immigration 102
4. Some recent significant events 104
CHAPTER 5 : Lebanon
By Harald Suermann 105
1. The different denominations 105
1.1. The Catholic particular Churches 105
a) Maronites 105
b) The Melkite or Greek Catholic 108
c) The Syriac Catholic 109
d) The Chaldeans 109
e) The Armenian Catholic 109
f) The Latins 110
1.2. The Orthodox and Protestants 111
a) The Greek Orthodox (Rum Orthodox) 111
aa) church structure 112
ab) The Orthodox Youth Movement 112
b) The Syriac Orthodox 113
c) The Armenian Orthodox 113
d) The Protestants 113
2. Assemblée des Catholiques au Liban Patriarches et Evêques (APECL) 114
3. History 114
3.1. Lebanon at the end of the Ottoman period 114
3.2. The independent Lebanon 116
a) The National Pact and the proportional representation 116
b) The development of denominations and church structures 119
3.3. From independence until the Civil War 120
3.4. The Civil War 124
a) The first phase 124
b) The second phase 125
c) southern Lebanon 127
3.5. From the Civil War to the Special Synod for Lebanon 128
3.6. Special Assembly of the Synod of Bishops for Lebanon 129
3.7. Further development 132
CHAPTER 6 : Jordan
By Harald Suermann 137
1. The different Churches 137
1.1. The Catholic particular Churches 137
1.2. The Orthodox and Protestants 138
2. Form of government 138
2.1. The tribal structure of the Jordanian Christians 139
2.2 . The Palestinian Christians 140
3. History 140
4. Inter-religious Relations 143
5. Ecumenism 144
6. Social Organization 144
CHAPTER 7 : The Holy Land
By Rainer Zimmer-Winkel 147
1. Introduction 147
2. The time until 1917 147
3. British rule in Palestine. Period of military rule (1917-20), time of the League of Nations mandate (1920-48 ) 150
4. The caesura 1947-48 152
5. The ecclesiastical situation since 1948 154
5.1. Development until 1967 154
5.2. Situation after 1967 155
5.3 . The visits of Paul VI (1964), John Paul II (2000) and Benedict XVI ( 2009) 156
6. The ecumenical situation in Jerusalem 157
7. The Catholic organization structure in the Holy Land 159
7.1. Roman Catholic institutions 159
a) The Catholic Ordinarienversammlung (Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land, AOCTS ) 159
b) The Latin Patriarchate 160
c) The Hebrew-speaking Catholics 161
d) Custodia Terrae Sanctae – The Custody of the Holy Land (Franciscans) 161
7.2 . The rite churches in communion with Rome 162
a) The Melkites 162
b) The Maronites 163
c) The Armenian Catholic Church 163
d) Syrian Catholic Church 163
e) The Chaldean and the Coptic Catholic Church 163
f) The Apostolic Nunciature in Israel 164
g) The Apostolic Delegation in Jerusalem and Palestine 164
7.3. Works and facilities 164
a) Caritas 165
b) Ecce Homo – Center for Biblical Formation 165
c) École Biblique 166
d) Justice and Peace Commission 166
e) Notre Dame de Jérusalem 166
f) Ecumenical Institute for Theological Studies Tantur 167
g) Equestrian Order of the Holy Sepulchre in Jerusalem
(Ordo Sancti Equestris Sepulchri Hierosolymitani) 167
h) Pontifical Mission for Palestine 168
i) Pontifical Biblical Institute 168
j) Religious and Heritage Studies in the Holy Land – Al- Liqa Center 168
k) Rosary Sisters 169
l) Faculty of Biblical Sciences and Archaeology 169
m) Bethlehem University 169
n) White Fathers (St. Anna ) – Biblical and Renewal Center 170
7.4. Church press and public relations 170
a) The Diocesan Bulletin 170
b) Associated Christian Press Bulletin 171
c) Proche-Orient Chrétien 171
d) Holy Land – Illustrated Quarterly of the Franciscan Custody of the Holy Land 171
e) Christian Information Centre – Franciscan Pilgrims ‚ Office 171
f) Holy Land Catholic Communications Centre 171
7.5. Palestinian theology 172
8. Concluding remarks 173
CHAPTER 8 : Arabian Peninsula ( The Apostolic Vicariate of Arabia
and the Vicariate Apostolic of Kuwait)
By Harald Suermann 175
1. History 175
2. Bahrain 179
3. Qatar 180
4. United Arab Emirates 180
4.1. Abu Dhabi 180
4.2 . Dubai 181
4.3. Sharja 181
5. Oman 181
6. Saudi Arabia 182
7. Apostolic Vicariate of Kuwait 184
CHAPTER 9 : Egypt
By Harald Suerman 185
1. Figures and churches 185
2. Form of government 186
2.1. History 186
2.2 . Sociology 190
2.3. Constitution 190
3. Social positions of Christians 192
3.1. Christian-Muslim relations 194
3.2 . Dialogue 198
4. The individual churches 199
4.1. The Coptic Orthodox Church 199
4.2 . The Greek Orthodox Church of the Patriarchate of Alexandria and All Afric 201
4.3. The Greek Orthodox autocephalous Archdiocese of Saint Catherine, Sinaï 201
4.4. The Armenian Orthodox Church 201
4.5. The Syrian Orthodox Church 202
4.6. The Episcopal Church 202
4.7. The Protestant churches 202
4.8. The Catholic particular Churches 202
a) The Latin Church 203
b) The Coptic Catholic Church 204
c) The remaining part of Catholic churches 205
d) The Catholic community facilities 206
5. Ecumenism 207
CHAPTER 10 : Maghreb
By Harald Suerman 211
1. Common characteristics 212
2. Libya 214
2.1. The colonial era 214
2.2. The independent Libya 215
3. Tunisia 216
3.1. The colonial era 217
3.2. The end of the colonial period 218
3.3. The church in independent Tunisia 220
4. Algeria 221
4.1. The colonial heritage 222
4.2. The period of the Republic 224
4.3. The crisis of Algerian society from 1992 to 1998 226
4.4. The period since 1998 228
5. Morocco 229
5.1. The colonial era 230
5.2 . The independent kingdom 231
CHAPTER 11 : Conclusions
By Harald Suermann 235
Register 243
1. Name register 243
2. Location register 247
3. Subject index 251
Authors 255
Apr 18 2011
Christen in Tunesien
Tunesien hat 9,8 Mill Einwohner, davon 30.000 Christen, mehrheitlich (22.000) ausländische Katholiken. In Tunesien ist der rechtliche Status der katholischen Kirche am eindeutigsten geregelt. 1964 gab es eine Konvention zwischen der tunesischen Regierung und dem Heiligen Stuhl. Diese Konvention garantierte sieben Kirchen im Land und gab auch die Möglichkeit, bei Bedarf um Erlaubnis für die Eröffnung weiterer Kapellen zu fragen.
Laut Verfassung ist der Islam Staatsreligion, aber die Regierung erlaubt die Ausübung anderer Religionen. Mission und das Verteilen von religiösem Material sind verboten
Die Kolonialzeit
Die Entstehung der katholischen Kirche in Tunesien ist mit der Errichtung des Protektorats (1881-1883) verbunden. Schon 1843 wurde ein Apostolisches Vikariat von Tunesien errichtet, das 1884 zur Erzdiözese von Karthago erhoben wurde. Ihr erster Bischof war Charles-Martial Allemand-Lavigerie.
Die Kirche in Tunesien widmete sich im 19. Jh. erzieherischen und karitativen Aufgaben
Institutionen des christlich-islamischen Dialogs
1927 wurde das Institut des Belles Lettres Arabes (I.B.L.A.) gegründet, ein Zentrum für arabische Sprache und Islamwissenschaften. Seit 1937 wird die Revue de l’I.B.L.A. herausgegeben. 1949 teilte sich das Institut: I.B.L.A. spezialisierte sich in den Studien zur tunesischen Kultur und der modernen arabischen Literatur. Das zweite mit dem Namen Institut Pontifical d’Études Arabes (IPEA) hatte zur Aufgabe, Kirchenpersonal, Kleriker und auch Laien auf Universitätsniveau auszubilden und wurde 1964 nach Rom verlegt. Aus dem Institut sind zahlreiche Persönlichkeiten hervorgegangen, die im französischsprachigen Raum oder in Rom zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils und danach wichtige Initiativen ergriffen und Institutionen für den Dialog mit dem Islam aufbauten. Hierzu gehören z.B. P. Cuoq, der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil das Sekretariat für die Beziehungen mit dem Islam aufgebaut hatte, oder auch P. Caspar, der 1977 in Tunis mit einigen christlichen und muslimischen Freunden die Groupe de Recherche Islamo-Chrétien (GRIC) gegründet hatte. Hier sollte von Anfang an die gleiche Zahl von Muslimen und Christen teilnehmen. Die Ansichten und Herausforderungen beider Religionen sollten auf akademischem Niveau diskutiert werden.
In den 80er Jahren geriet GRIC in eine Krise, so dass man 1991 sogar die Auflösung in Betracht zog. Die Krise scheint aber soweit überwunden zu sein, dass optimistisch in die Zukunft gesehen werden kann.
Das Ende der Kolonialzeit
Der Übergang von der Kolonialzeit zur Unabhängigkeit Tunesiens war von vielen Spannungen und tiefgreifenden Änderungen auch für die Kirche geprägt. 1930 fand der Eucharistische Kongress in Karthago statt. Die Tatsache, dass sich Frankreich offiziell auf dem Kongress vertreten ließ, war bei den tunesischen Nationalisten wie auch bei einigen Kirchenvertretern umstritten. Der spätere Präsident Bourghiba sah in dem Kongress einen neuen Kreuzzug. Es war der symbolische Höhepunkt des Geistes der französischen Kolonialisierung im Verbund mit der Kirche. Durch die Weitsichtigkeit einiger Priester und Bischöfe gelang es, die Kirche mit guter Hand in die Zeit der Unabhängigkeit zu führen.
Am Vorabend der Unabhängigkeit gab es noch etwa 255.000 Nicht-Muslime unter den 3,4 Mill. Einwohnern Tunesiens. Abgesehen von den 60.000 Juden war die große Mehrheit katholisch. 100.000 Katholiken lebten in Tunis, der Rest über das Land verteilt. 78 Pfarren mit 100 Kirchen und Kapellen wurden von 228 Priestern, davon 153 Diözesanpriestern, versorgt.
Die Diözese wurde seit 1953 von Mgr. Maurice Perrin geleitet. Zur Zeit der französisch-tunesischen Krise (1950-1954) zeigte er sich moderat. Aufgrund seiner Offenheit wurde er nicht von der Unabhängigkeit Tunesiens überrascht und wusste, dass sich das Schicksal der Kirche in den folgenden Jahren entscheiden würde. Msgr. Michel Hervé-Bazin gab die diözesane Wochenzeitung La Tunisie Catholique heraus, die auch auf den Islam und muslimische Fragen einging und so versuchte, den Blick der Gläubigen für die gesellschaftliche Mehrheit zu öffnen. P. André Demeerseman war Weißer Vater und am IBLA tätig. Als Schüler von P. Henri Marchal favorisierte er eine Missionsarbeit ohne Werke und Konversion und hatte sich mehrmals für die Unabhängigkeit Tunesiens eingesetzt.
Die Hierarchie war sich der schwierigen Übergangszeit bewusst, als sich unter den Gläubigen beginnende Unruhe ausbreitete. Obwohl die vatikanische Presse bei der Ernennung von Msgr. Perrin schon darauf hinwies, dass die katholische Präsenz in Tunesien von den Ausländern abhinge, pflegte man die religiösen Aktivitäten weiter, als stünden keine Umbrüche bevor. Andererseits zeigte der Erzbischof Gesten guten Willens und ließ 1953 die Statue von Kardinal Lavigerie vor dem Eingang zur Medina entfernen. Er gab die Kapellen auf und benannte die Wochenzeitung La Tunesie Catholique in L’Écho du diocèse de Carthage
Die Kirche im unabhängigen Tunesien
Nach der Unabhängigkeit Tunesien (1956) kam es zu einer deutlichen zahlenmäßigen Reduzierung der Christen. 1959 kam es aber zu ersten Verboten kirchlicher Aktivitäten und der Enteignung von Gebäuden.
Am 19. Juni 1959 statte der tunesische Staatspräsident Bourghiba dem Vatikan einen ersten Besuch ab. Papst Johannes XXIII. empfing ihn in seiner Privatbibliothek. Er forderte dabei klar ein direktes Abkommen zwischen dem Vatikan und Tunesien, da die Abkommen aus der Kolonialzeit überholt seien. Ein zweiter Besuch fand am 23. September 1962 statt, am Vorabend der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Doch wurde erst bei einem Besuch des tunesischen Außenministers am 16. Februar 1963 entschieden, Verhandlungen über den Status der katholischen Kirche in Tunesien aufzunehmen.
1964 kam es zu einem Abkommen zwischen der tunesischen Republik und dem Vatikan. Der Vatikan übergab dem Staat ersatzlos fast alle Kultorte, sieben verblieben im Kirchenbesitz. Dafür anerkannte der Staat den Kult der katholischen Kirche, der frei, aber diskret ausgeübt werden soll. Priester können einreisen und eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Der Bischofstitel wurde verweigert und das Erzbistum von Karthago wurde zur Territorialprälatur Tunis. Es war auch ein Neuanfang für die Kirche, die nun dem Land dienen sollte und nicht mehr protegierte Kolonialkirche war.
1968 fand eine Synode statt, auf der die Kirche sich entschied, bevorzugt im Erziehungs- und Gesundheitswesen sowie im sozialen Bereich tätig zu sein. Damit vollzog sich ein großer Wandel.
Am 30. Mai 1992 wurde der jordanische Priester Fuad Twal zum Bischof von Tunesien ernannt und am 31. Mai 1995 konnte die Territorialprälatur Tunis zum Bistum erhoben werden. Im April 1996 besuchte Papst Johannes-Paul II. Tunesien und gab in seinen Reden der Verteidigung der Menschenrechte einen neuen Impuls.
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ergriff die Regierung einige Maßnahmen, um die Sicherheit zu erhöhen und Aufstände zu vermeiden. Sie förderte auch den interreligiösen und interkulturellen Dialog.
Am 8. September 2005 wurde der Jordanier Msgr. Maroun Elias Nimeh Lahham zum Bischof von Tunesien ernannt.
Seit den Unruhen
Auf der Sonderversammlung der Bischofssynode zum Nahen Osten in Rom hatten die Bischöfe unter anderem einen säkularen Staat (sie nannten es zivilen Staat) und Religionsfreiheit, nicht nur Kultfreiheit gefordert. Auf der Versammlung der Nordafrikanischen Bischofskonferenz (CERNA) vom 29. Januar bis zum 2. Februar begrüßten sie den Wandel, den sie wenige Monate zuvor in Rom gefordert hatten. Ihrer Ansicht nach waren die Christen Teil des Wandels, und sie unterstützten die Forderungen der Bürger nach mehr Freiheitsrechten und der Teilhabe an der Regierung des Landes. Als kleine, ausländische Minderheit konnten sie aber den Wechsel nur wenig mitgestalten.
Nachdem auch die Unruhen in Libyen begannen und von dort nun große Flüchtlingsströme ins Land kommen, sorgt sich die Kirche im Rahmen ihrer Möglichkeiten um die Gestrandeten.
Doch der Wandel in Tunesien ist nicht ohne Makel. Am 18. Februar wurde der Salesianerpater Marek Rybinski ermordert in der Schule aufgefunden. Wahrscheinlich wurde er wegen 1000 EUR umgebracht. Er war das erste ausländische und christliche Opfer seitdem der frühere Präsident Ben Ali verjagt worden war. In den Tagen gab es auch Islamisten, die in gegen die Prostitution in einem Viertel von Tunis vorgingen und dort Feuer legen wollten. Anfang Februar hat die jüdische Gemeinschaft ihre Sorge zum Ausdruck über antisemitische Vorfälle vor der Synagoge zu Ausdruck gebracht. Solche Vorfälle können auch die Kirche über die Zukunft Tunesiens beunruhigen.
Mär 23 2011
Christen in Libyen
Libyen hat etwa 6,4 Mill. Einwohner, darunter etwa 75.000 Katholiken. Von ihnen wohnen die meisten im Apostolischen Vikariat von Tripolis, deutlich weniger gehören zum Apostolischen Vikariat von Banghazi. Das Apostolische Vikariat von Derna ist seit 1948 vakant, ebenso seit 1969 die Apostolische Präfektur von Misurata.
Nach der Revolution im September 1969 wurde am 10. Oktober 1970 ein Abkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem libyschen Staat unterzeichnet. Der gesamte Kirchenbesitz wurde nationalisiert, zwei Kirchengebäude wurden der katholischen Kirche zur Nutzung überlassen. Zehn Priester dürfen maximal im Staat tätig sein. Allerdings wurden Hunderte Schwestern für den Krankenhausdienst angeworben.
Die Kolonialzeit
Nachdem italienische Truppen die Küstenstädte Libyens besetzt hatten, kam 1911 Mgr. Antonnelli nach Libyen und errichtete am 23. Februar 1913 das Apostolische Vikariat von Libyen. Sein Nachfolger P. Tonizza kümmerte sich um die Infrastruktur und ließ eine Kathedrale, Kindergärten, Schulen und Pfarrzentren errichten. 1927 wurde das Apostolische Vikariat aufgeteilt in das von Tripolitanien und in das von Banghazi in der Kyrenaika. Obwohl die Kirche während der Besatzungszeit auch die Aufgabe, die Soldaten zu betreuen, pflegte sie in Libyen immer auch sehr gute Beziehungen zur muslimischen Bevölkerung.
Das unabhängige Libyen
1951 wurde Libyen unabhängig und bildete ein konstitutionelle Monarchie unter König Idris al-Sanussi.
Am 1. September 1969 riss Mu‛ammar al-Qaddafi die Macht an sich. Am 21. Juli 1970 kündigte er die sofortige Konfiszierung der Güter der Italiener und ihre Ausweisung an, was bis September des Jahres abgeschlossen waren. Davon war auch die Kirche betroffen. Nach zähen Verhandlungen konnten sechs Missionare im Land bleiben und in Tripolis und Banghazi wurde ihnen der Kult erlaubt. Der größte Teil der Kirchen wurde geschlossen, obwohl die Verfassung Religionsfreiheit garantieren soll. Die Kathedrale der Hauptstadt wurde in eine Moschee umgewandelt. Im Nachhinein wird dieser Akt als eine „Reinigung“ der Kirche angesehen, die damals fast rein italienisch war. Heute ist sie wirklich international.
Vom 2. bis 5. Februar 1976 fand ein Kongress für den islamisch-christlichen Dialog in Tripolis statt. In Folge dieses Dialogs wurde die Kirche in Banghazi den Christen zurückgegeben und später ein zweiter Bischofssitz errichtet. Schließlich führte er zu den diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan.
1977 proklamierte al-Qaddafi die Errichtung der Sozialistischen Libysch-Arabischen Volks-Jamahiriya. In der Folgezeit kamen Gastarbeiter aus den Philippinen, aus Polen und Korea in das Land, wo durch die Zahl der Christen im Land wieder wuchs. Seit 1988 kamen dann arabische Christen als Arbeit.
1986 wurde der katholische Bischof von Tripolis, Giovanni Martinelli, zusammen mit drei Priestern und einer Ordensfrau für zehn Tage verhaftet. Diese Aktion wird oft als Racheakt für die offizielle Begegnung zwischen Papst Johannes-Paul II. und dem Rabbiner von Rom im selben Jahr gesehen.
Nach dem in den 80er Jahre sich die Beziehungen zwischen dem libyschen Staat und dem Heiligen Stuhl schrittweise verbesserten, wurden schließlich 1997 zwischen dem Vatikan und Libyen diplomatische Beziehungen aufgenommen und die zwei Apostolischen Vikariate, Banghazi und Tripolis, errichtet.
Der Staat zeigt sich seit 2004 deutlich stärker am interreligiösen und interkulturellen Dialog interessiert und eine Anzahl von Veranstaltungen fanden statt.
Im Februar 2006 wurden die Kirche in Banghazi und das Haus der Franziskaner in Brand gesetzt. Dies geschah in Folge der Unruhen, die die Muḥammad-Karikaturen in Dänemark ausgelöst hatten.
Die Kirche in Libyen ist sehr sozial engagiert. Verschiedene Orden arbeiten in Zentren für Behinderte, Waisen und Alte oder in Krankenhäuser.
Seit den Unruhen
Vom 29. Januar bis zum 2. Februar hatten sich die Bischöfe der Nordafrikanischen Bischofskonferenz (CERNA), unter ihnen auch die Bischöfe von Tripolis und von Banghazi, in Algier (Algerien) getroffen. Auf ihrem Treffen sagten sie, dass die Christen im Nahen Osten Teil des Wechsels sind, sie widersetzen sich ihm nicht. Die Proteste seien ein Zeichen des Wunsches nach Freiheit und Würde, besonders in der jungen Generation. Die Bewohner fordern als Bürger mit allen Rechten und Verantwortungen an dem Regieren des Landes teilzuhaben. Die Bischöfe fordern auch einen größeren Respekt der Religionsfreiheit im Rahmen der Menschenrechte. In Libyen konnten unter Gaddafi die Christen ihren Kult ausüben. Sie konnten nicht nur in den Kirchen die Messen feiern, sondern auch in Privathäusern und in Firmen. Auch Gefängnisseelsorge war möglich.
Die Christen befürchten, dass mit dem Sturz von Gaddafi, es zu einer islamistischen Regierung kommen wird, die dann die Freiheiten der Christen weiter einschränkt.
Während die meisten Ausländer das Land verlassen haben, stehen die Arbeitsmigranten aus dem subsaharischen Afrika häufig vor der Schwierigkeit, dass sie keine ausreichenden Ausweispapiere haben. Viele von ihnen haben Zuflucht in bei den Kirchen gesucht. Diesen versuchen Ordensleute im Land über ihre Botschaften und dem UNHCR zu helfen. Die Bischöfe, Priester und Ordensleute, mit sehr wenigen Ausnahmen, bleiben im den Land bei den Christen, die es nicht verlassen können.
Die Kirche besteht ausschließlich aus Ausländern, und so sind ihr die Hände in dem Konflikt gebunden. Sie kann nicht eingreifen oder Partei ergreifen. Ihre Chance und Aufgabe besteht darin, bei den Wehrlosen zu bleiben und Solidarität zu zeigen. Ihre politische Option hat sie in der Bischofskonferenz klar zu Ausdruck gebracht, ohne sie durchsetzen zu können.
Der Beitrag basiert auf der Veröffentlichung: Harald (Hg.), Kirche und Katholizismus seit 1945. Bd 7: Vorderer Orient und Nordafrika. Paderborn 2010, 214-216.
Feb 08 2011
Christen in Palästina – Geschichte und Gegenwart
Ausgewählte Literatur zur Geschichte von Christentum, Theologie und Gesellschaft in Palästina
Geschichte
- F.M. Abel, Histoire de la Palestine depuis la conquête d’Alexandre jusqu’à l’invasion Arabe, Paris 1952.
- Bellarmino Bagatti, The Church from the Gentiles in Palestine. History and Archaeology. Jerusalem ²1984 (Studium Biblicum Franciscanum. Collectio Minor ; 4).
- G. Batch, Les Chrétiens de Palestine sous la domination Ottomane, 1963.
- Georges Bateh, Statut personnel. Introduction à l’étude de la condition juridique des chrétiens de Palestine sous la domination ottomane (1517-1917), Rom 1963.
- John Binns, Ascetics and Ambassadors of Christ: the Monasteries of Palestine, 314-631, Oxford 1994.
- John Binns, The Distinctiveness of Palestinian Monasticism, in: J. Loades (Hrsg.), Monastic Studies: The Continuity of Tradition, Bangor 1990, 11-20.
- Amnon Cohen, The Ottoman Approach to Christians and Christianity in Sixteenth-Century Jerusalem, in: Islam and Christian-Muslim Relations 7, 1996, 205-212.
- Amnon Cohen, The Receding of the Christian Presence in the Holy Land: a 19th Century Sijill in the light of 16th Century Tahrirs, in: Thomas Philipp (Hrsg.), The Syrian Land in th 18th and 19th Century, Stuttgart 1992, 333-340.
- Herbert Donner, Pilgerfahrt ins Heilige Land. Die ältesten Berichte christlicher Palästinapilger (4.-7. Jahrhundert). Stuttgart 1979.
- George Every, Syrian Christians in Palestine in the Early Middle Ages, in: Eastern Churches Quarterly 6, 1946, 363-372.
- Frank Foerster, Mission im Heiligen Land. Der Jerusalems-Verein zu Berlin 1852 -1945, Gütersloh 1991 (Missionswissenschaftliche Forschung 25).
- Francesco Gabrieli, Die Kreuzzüge aus arabischer Sicht. München ²1976.
- S. H. Griffith, Antony David of Baghdad, Scribe and Monk of Mar Sabas. Arabic in the Monasteries of Palestine, in: Church History 58, 1989, 7-19.
- Moshe Gil, A History of Palestine 634-1099, Cambridge 1992.
- Sidney Griffith, Stephen of Ramlah and the Christian Kerygma in Arabic in Ninth Century Palestine, in: Journal of Ecclesiastical History 36, 1985, 23-45.
- Sidney H. Griffith, Antony David of Baghdad, Scribe and Monk of Mar Sabas. Arabic in the Monasteries of Palestine, in: Church History 58 (1989) 7-19.
- Sidney Griffith, Theodore Abû Qurrah. The intellectual profile of an Arab Christian writer of the first Abbasid Century, Tel Aviv 1992 (The Dr. Irene Halmos Chair of Arabic Literatur).
- Sidney H. Griffith, The View of Islam from the Monasteries of Palestine in the Early `Abbasid Period: Theodore Abu Qurrah and the Summa Theologiae Arabica , in: Silam and Muslim-Christian Relations 7, 1996, 9-28.
- Joseph Hajjar, L‘Europe et les Destinées du Proche-Orient. Damaskus 1988-1996.
- Bernard Hamilton, The Latin Church in the Crusader States: the Secular Church, London 1980.
- Friedrich Heyer, Kirchengeschichte des Heiligen Landes. Stuttgart 1984.2. überarb. und um Anmerkungen erweiterte Auflage, Hamburg 2000, (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte)
- Kevork Hintlian, History of the Armenians in the Holy Land, Jerusalem 1976.
- Y. Hirschfeld, The Judean Desert Monasteries in the Byzantine Periode, Yale 1992.
- Y. Hirschfeld, List of the Byzantine Monasteries in the Judean Desert, in : G. C. Bottini, L. Di Segni, E. Allata (Hrsg.), Christian Archeology in the Holy Land, Jerusalem 1990, 1-90.
- Martin Hoch, Jerusalem, Damaskus und der Zweite Kreuzzug. Konstitutionelle Krise und äußere Sicherheit des Kreuzfahrerkönigreiches Jerusalem, A.D. 1126-1154, Frankfurt/M. 1993 (Europäische Hochschulschriften 3. Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 560).
- G. Hurton, La question greco-arabe ou l’hellénisme en Palestine et en Syrie, Arras 1895.
- Halil Inalcik, The Status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans, in: Turcia 21-23, 1991, 407-437.
- Anton Odeh Issa, Les Minorités Chrétiennes de Palestine. A travers les siècles. Jerusalem 1976.
- Andrej Kreutz, The Vatican and the Palestinians. A historical overview, in: Islamochristiana 18, 1992, 109-125.
- Andreas Külzer, Peregrinatio graeca in Terram Sanctam. Studien zu Pilgerführern und Reisebeschreibungen über Syrien, Palästina und den Sinai aus byzantinischer und metabyzantinischer Zeit , Frankfurt/M. 1994 (Studien und Texte zur Byzantinistik 2).
- A. Linder, Christian communities in Jerusalem, in: J. Prawer, H. Ben-Shammai (Hrsg.), The History of Jerusalem: The Early Muslim Period 638-1099, New York 1996, 121-162.
- Anneliese Lüders, Die Kreuzzüge im Urteil syrischer und armenischer Quellen, Berlin 1964 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für Griechisch-Römische Altertumskunde, Berliner Byzatninistische Arbeiten ; 29).
- M. Maoz, Ottoman Reform in Syria and Palestine 1840-1861. The Impact of the Tanzimat in Politics and Society, London 1968.
- P. Médebielle, Gaza et son histoire chrétienne, Jérusalem 1982.
- Anthony O’Mahony, Göran Gunner, Kevork Hintlian (Hrsg.), The Christian Heritage in the Holy Land, London 1995.
- Andrew Palmer, The history of the Syrian Orthodox in Jerusalem, in: Oriens Christianus 75, 1991, 10-24.
- Kirsten Pedersen, The History of the Ethiopian Community in the Holy Land from the time of Emperor Tewodros II Till 1974. Jerusalem 1983 (Studia Oecumenica Hierosolymitana).
- Lorenzo Perrone, Monasticism in the Holy Land: From the beginnings to the Crusaders, in: Proche-Orient Chrétiens 45, 1995, 31-63.
- Alexei Poley, Jérusalem des Coptes. Deux mille ans dans la ville sainte, in: Le Monde Copte 23, Nov. (1993) 49-57.
- Joseph Prawer, Social Classes in the Crusader States: the “Minorities”, in: A History of the Crusades, Wisconsin 1985, Bd. 5, 59-116
- Richard Rose, Pluralism in a Medieval Colonial Society: the Frankish Impact on the Melkite Community during the First Crusader Kingdom of Jerusalem 1099-1187 , (Ph.D. University of California), Los Angeles 1981.
- Richard Rose, The Native Christians of Jerusalem, 1187-1260, in: B.Z. Kedar (hrsg.), The Horns of Hattin, London 1992, 239-249.
- Richard Rose, The Crusader Period in the Holy Land and Ecclesiology, in: D.-M. A. Jaeger (hrsg.), Christianity in the Holy Land, Jerusalem 1981, 169-196.
- Richard Rose, Jerusalem and Jihad: The Devotion of the Iberian Nation to Jerusalem: a footnote on the Role of the Georgians in Late Medieval Jerusalem, in: Proche-Orient Chrétien 41, 1991, 10-24.
- N. Rosovsky (Hrsg.), City of the Great King: Jerusalem from David to the Present, Harvard 1996
- Adel El-Sayed, Palästina in der Mandatszeit. Der palästinensische Kampf um politische Unabhängigkeit und das zionistische Projekt. Zur Dynamik eines Interessenkonflikts – vom Zerfall des Osmanischen Reiches bis zur Gründung des Staates Israel im Jahre 1948, Frankfurt/M. 1996 (Europäische Hochschulschriften Reihe 31, Politikwissenschaft 310).
- Robert Schick, Fate of the Christians in Palestine during the Byzantine-Umayyad transition 600-750 AD (unpublished Ph.D., University of Chicago 1987.
- Robert Schick, The Christian communities of Palestine from Byzantine to Islamic rule: a historical and archaeological study, Princeton 1995
- G. Stemberger, Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosius. München 1987.
- Martin Strohmeier, Al-kulliyya as-salâhiyya in Jerusalem – Arabismus, Osmanismus und Panislamismus im ersten Weltkrieg, in: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes XLIX,4, Stuttgart 1991.
- Speros Vryonis, The Byzantine Patriarchate and Turkish Islam, in: Byzantino-Slavica 57, 1996, 69-111.
- P.W.L. Walker, Holy City. Holy Places? Christian Attitudes to Jerusalem and the Holy Land in the Fourth Century, Oxford 1990
- Roland Werner, Verbindungen zwischen der nubischen Kirche und dem syro-palästinischen Raum im Mittelalter , in: Martin Tamcke, Wolfgang Schwaigert, Egbert Schlarb (Hrsg.), Syrisches Christentum weltweit. Studien zur syrischen Kirchengeschichte. Festschrift Wolfgang Hage, Münster 1995, 278-306 (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 1).
- Robert Wilken, The Land Called Holy. Palestine in Christian History and Thought, New Haven, London 1992.
- J. Wilkonson, Jerusalem Pilgrims before the Crusades, Jerusalem 1977.
- Ya’acov Willebrands, Über die Mönchstradition Palästinas. Mit einem Vorwort von Erzbischof Lutfi Laham, Jerusalem, Trier 1994 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA 20).
- Akten der International Conferences on Bilad al-Sham, Amman 1984ff.
top Gegenwart
- Said K. Aburish, The forgotten faithful : the Christians of the Holy Land London, 1993
- Thomas L. Are, Israeli Peace, Palestinian Justice: Liberation Theology and the Peace Process. Atlanta, 1994.
- Na’im Stifan ‚Ateek, Recht, nichts als Recht! Entwurf einer palästinensisch-christlichen Theologie, Fribourg/Brig 1990.
- Naim Ateek, M. Ellis and Rosemary Radford Ruether (Hrsg.). Faith and the Intifada: Palestinian Christian Voices. New York 1992.
- Naim Ateek, Cedar Duaybis, and Marla Schrader (Hrsg.). Jerusalem: What Makes For Peace? A Palestinian Christian Contribution to Peacemaking. London 1997.
- Naim Ateek and Michael Prior (Hrsg.), Holy Land – Hollow Jubilee: God, Justice and the Palestinians . London 1999.
- Ulrike Bechmann, Mitri Raheb (Hrsg.), Verwurzelt im Heiligen Land. Einführung in das palästinensische Christentum. Frankfurt/M 1995.
- Ulrike Bechmann, Gespür für die Leidenden, in: Junge Kirche 54, 1993, 663-670.
- Ulrike Bechmann, Palästinensische Christen und Christinnen – die unbequeme Seite des christlich-jüdischen Dialogs, in: Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Frankfurt/Main (Hg.), mich erinnern – dich erkennen – uns erleben. 50 Jahre Gesellschaft für christlich-jüdische zusammenarbeit in Frankfurt am Main 1949-1999, Frankfurt 1999, S. 169-179.
- Ulrike Bechmann, Vom Dialog zur Solidarität – Das christlich-islamische Gespräch in Palästina, Trier 2000 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA, Sonderheft 6).
- Ulrike Bechmann, Ottmar Fuchs (Hg.) Von Nazareth bis Bethlehem: Hoffnung und Klage. Mit einem Forschungsbericht von Saleh Srouji. Münster 2002 (Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie und Religionspädagogik 4)
- Dirk Biestmann-Kotte, Die Menschen, das Land und der Ölzweig. Palästinensische Christen für Frieden und Gerechtigkeit. Mit einem Vorwort von Viola Raheb,Trier 2002 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA, Sonderheft 10)
- Jean-Michel Billioud, Histoire des Chrétiens d’Orient, Paris 1995. (Collection „Comprendre le Moyen-Orient“).
- Frans Bouwen, Prier et vivre pour l’unité à Jérusalem à la lumière de l’encyclique „Ut unum sint“, in: Proche-Orient Chrétien 45, 1995, 132-142.
- Glenn Bowman, Christian pilgrimage. Structures of devotion/structures of obedience, in: The Month, December 1993, 491-498.
- Glenn Bowman, Christian ideology and the image of a holy land: the place of Jerusalem pilgrimage in the various Christianities, in: J. Eade, M. Sallnow (Hrsg.), Contesting the Sacred. the Anthropology of Christian Pilgrimage, London 1991, 98-121.
- Glenn Bowman, The politics of tour guiding. Israeli and Palestinian guides in Israel and the Occupied Territories, in: D. Harrison (Hrsg.),Tourism and the Less Developed Countries, London 1992.
- Glenn Bowman, Nationalizing the sacred. shrines and shifting identities in the Israeli-occupied territories, in: Man: The Journal of the Royal Anthropological Institute 28,3, 431-460.
- Wilhelm Breder, Der Staat Israel in der christlichen Theologie. Mit einem Vorwort von Hermann Lichtenberger, Trier 1994 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA 10).
- Gary M. Burge, Who are God’s People in the Middle East? Grand Rapids, Mich., 1993.
- David Burrel, Y. Landau, Voices from Jerusalem. Jews and Christians reflect on the Holy Land, New York 1992.
- Elias Chacour, Auch uns gehört das Land. Ein israelitischer Palästinenser kämpft für Frieden und Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 1993 (Übersetz. v. We belong to this Land).
- Elias Chacour, Und dennoch sind wir Brüder, Frankfurt/M. 1980.
- Elias Chacour, We Belong to the Land. Harper Collins, 1990. [dt. Auch uns gehört das Land. Ein israelischer Palästinenser kämpft für Frieden und Gerechtigkeit. Frankfurt/M. 1993]
- Colin Chapman, Whose Promised Land? (2nd Edition). Tinq u.a. 1992.
- Les Chrétiens du monde arabe. Problématiques actuelles et enjeux. Actes du Colloque des CMA à Paris (Septembre 1987). Paris 1989.
- Christiane na vostoke : iskusstvo mel’kitov i inoslavnych christian = Christians in the Holy Land / Gosudarstvennyj Ermitaz. – Sankt-Peterburg, 1998
- Duncan Clarke, E. Flohr, Christian Churches and the Palestine Question, in: Journal of Palestine Studies 21, 1992, H.4, S.67-79.
- Richard I. Cohen (Hg.), Vision and Conflict in the Holy Land, Jerusalem 1985.
- Saul P. Colbi, Christianity in the Holy Land Past and Present, Tel Aviv 1969.
- Saul P. Colbi, Short History of Christianity in the Holy Land, Tel Aviv 1966.
- Saul P. Colbi, A History of the Christian Presence in the Holy Land, New York, London 1988.
- Jean Corbon, L’Église des Arabes. Paris 1977.
- Kenneth Cragg, The Arab Christian: A History in the Middle East. Westminster, 1991.
- Thomas Damm, Palästinensische Befreiungstheologie. Annäherung und Würdigung aus der Sicht eines deutschen Theologen, Trier 1. Auflage 1993; 3. erw. Aufl. 1999 (Kulturverein AphorismA Kleine Schriftenreihe 5).
- Stavro Danilov, Dilemmas of Jerusalem’s Christians, in Middle East Review 13, 1981.
- Stefan Durst, Jerusalem als ökumenisches Problem im 20. Jahrhundert, Pfaffenweiler 1993 (Religion in Geschichte und Gegenwart 2).
- H. F. Ellis (ed.), The Vatican, Islam and the Middle East, New York 1987.
- Marc Ellis, Toward a Jewish Theology of Liberation: the Uprising and the Future. Orbis. 1989. [dt. Übers. Zwischen Hoffnung und Verrat. Schritte auf dem Weg einer jüdischen Theologie der Befreiung, Luzern 1992].
- Marc H. Ellis, Beyond Innocence and Redemption. Confronting the Holocaust and Israeli Power. New York 1991.
- Marc Ellis, Ending Auschwitz: the Future of Jewish and Christian Life Westminster 1994.
- Marc H. Ellis, Zwischen Hoffnung und Verrat. Schritte auf dem Weg einer jüdischen Theologie der Befreiung. Luzern 1992.
- Marc Ellis, After Auschwitz and the Palestinian Uprising, in: Culture Religion and Liberation, in: Africa Continental Conference 6-11 January 1991. University of Zimbabwe. A Conference Report, hrsg. v. Eatwot African Office, Harare 1991, 101-126.
- Marc H. Ellis, Über den jüdisch-christlichen Dialog hinaus: Solidarität mit dem palästinensischen Volk, 3. erheblich erw. Aufl., Trier 1997, (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA 4).
- Marc H. Ellis, Jewish theology and the Palestinians, in: Journal of Palestine Studies 19, 1990, 39-57.
- George Emile Irani, The Holy See and the Israeli-Palestinian Conflict, in: Kail C. Ellis (Hrsg.), The Vatican, Islam, and the Middle East, New York 1987, 125-142.
- Chad F. Emmett, Beyond the Basilica. Christians and Muslims in Nazareth, Chicago 1995.
- Ottmar Fuchs, Der erbitterte Streit um das Land. Wider den nationalistischen Mißbrauch des Alten Testaments, in: Publik-Forum 22, 1994, 24-26.
- Ottmar Fuchs, Ortsbegehung palästinensischer Erfahrungen und Theologie, in: Pastoraltheologische Informationen 17, 1997, 79-98.
- A. Giovanneli, La Santa Sede e la Palestina: la custodia di Terra Santa tra la fine dell’impero ottomano e la guerra dei sei giorni, Rome 2000 (Religione e Società)
- Hans-Martin Gloel, Palästinensische Befreiungstheologie, Arabische Christen suchen einen Weg zum Frieden, in: Nachrichten der ev.-luth. Kirche in Bayern, 15/16. 1992, S. 294-296.
- Uwe Gräbe, A Bibliography on Contextual Palestinian Theology, in: Al-Liqa‘ Journal 6 (1996) 49-64.
- Uwe Gräbe, Kontextuelle palästinensische Theologie. Streitbare und umstrittene Beiträge zum ökumenischen und interreligiösen Gespräch, Erlangen 1999 (Missionswissenschaftliche Forschungen ; N.F., Bd. 9).
- H. Guthe, Die griechisch-orthodoxe Kirche im Heiligen Land, in: Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins 12, 1889, 81-91.
- Hassan Haddad and Donald Wagner. All in the Name of the Bible: selected essays on Israel and American Christian Fundamentalism. Amana, 1986.
- Grace Halsell, Prophecy and Politics. Militant Evangelists on the road to Nucler War,Westport 1986.
- Susann Heenen-Wolff, Erez Palästina. Juden und Palästinenser im Konflikt um ein Land, Frankfurt/Main 1987.
- J. Henningsson, Theological Frontiers in the Middle East, in: Life & Peace Review 3, 1990.
- Friedrich Heyer, Die Arabisierung der Kirchen im Heiligen Land, in; Martin Tamcke (Hg.) Orientalische Christen zwischen Repression und Migration. Beiträge zur jüngeren Geschichte und Gegenwartslage, Münster 2001 (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 13) 43-52
- Alison Hilliard, Betty Jane Bailey, Living Stones Pilgrimage with the Christians of the Holy Land, London 1999.
- George Emile Irani, The Holy See and the Israeli-Palestinian Conflict, in: Kail C. Ellis (Hg.), The Vatican, Islam, and the Middle East (New York 1987) 125-42.
- Jerusalem Between Religious Freedom and Political Sovereignty (A Day of Reflection, 20/4/1995), Jerusalem 1995.
- A. Kapeliouk, Les Arabes chrétiens en Israel (1948-1967) (Thèse de doctorat, l’université de Paris, Sorbonne 1968).
- A. Kapeliouk, L’État social, économique, culturel et juridique des Arabes chrétiennes en Israel, in: Asian and African Studien 5, 1969, 51-95.
- Fred J. Khouri, The Jerusalem Question and the Vatican, in: Kail C. Ellis (Hrsg.), The Vatican, Islam, and the Middle East, New York 1987, 143-162.
- Geries Sa´ed Khoury, Olive Tree Theology – Rooted in the Palestinian Soil, in: Missionswissenschaftliches Institut Missio e.V. (Hrsg.), Jahrbuch für kontextuelle Theologien 93, Frankfurt am Main 1994, 38-75.
- Rafiq Khoury, La Catéchèse dans l’Eglise locale de Jérusalem, Rom 1978.
- Rafiq Khoury, Palästinensisches Christentum – Erfahrungen und Perspektiven, Trier 1993 (Kulturverein AphorismA Kleine Schriftenreihe 7).
- Rana Khoury, Palästinensische Frauen und die Intifada, Trier 1996 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA 30).
- Charles Kimball, Angle of Vision, New York 1992.
- Michael C. King, The Palestinians and the Churches 1948-1956, Genf 1981.
- A. Kreutz, Vatican Policy on the Palestinian/Israeli Conflict. The Struggle for the Holy Land, New York 1990.
- Charles Kimball, Angle of Vision. Friendship Press, 1992.
- Kai Kjaer-Hansen, Ole Chr. M. Kvarme, Messianische Juden. Judenchristen in Israel. Erlangen 1983.
- Andrej Kreutz, Vatican Policy on the Palestinian-Israeli Conflict. The Struggle for the Holy Land, New York, London 1990.
- Andrej Kreutz, The Vatican and the Palestinians: A Historical Overview, in: Islamochristiana 18, 1992, 109-125.
- Lutfi Laham, Hoffnung auf eine Ökumene in Jerusalem, Köln 1985.
- Al-Liqa‘-Journal (engl.) 1 (1992ff.).
- Paul Löffler, Zur Lage palästinensischer Christen heute, in; Martin Tamcke (Hg.) Orientalische Christen zwischen Repression und Migration. Beiträge zur jüngeren Geschichte und Gegenwartslage, Münster 2001 (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 13) 53-63
- Ian Lustick, For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel. New York 1988.
- Lee I. Levine (Hrsg.), Jerusalem. Its sactity and centrality to Judaism, Christinity, and Islam, New York 1999.
- Joseph Maalouf, La liberté religieuse en Israël, in: La Liberté Religiuese au Moyen-Orient, hrsg. v. Centre de Théologie pour le Moyen-Orient, Beyrouth, Jounieh, Zahlé, 1995, 209-235.
- Otto Maduro (Hg.), Judaism, Christianity, and Liberation. An Agenda for Dialogue, New York 1991.
- Anthony O ‚Mahony with Gunner, Goran and Hintlian, Kevork (ads.). The Christian Heritage in the Holy Land. London l995.
- Anthony O’Mahony (ed.), Palestinian Christians. Religion, Politics and Society in the Holy Land, London 1999.
- W. Eugene March, Israel and the Politics of Land: A Theological Case Study. Westminster 1994.
- F. Margiotta Broglio, Gerusalemme capitale e il problema dei Luoghi santi dopo il viaggio di Giovanni Paolo II, in: Rivista di studi Politici Internazionali 266/67, 2000, 179-197
- Nabil I. Matar, Protestantism, Palestine, and Partisan Scholarship, in: Journal of Palestine Studies 18, 1989, H. 4, S. 52-70.
- André Elias Mazawi, Palestinian Local Theology and the Issue of Islamo-Christian Dialogue: An Appraisal, in: Islamochristiana 19, 1993, S. 93-115.
- Jeremy Milgrom, Die Verantwortung der Macht – Friedenschaffen in Israel – Beiträge über das Fremde, das Nationale, das Humane. Mit einem Vorwort von Jörg Hasler, Trier 1994 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA 8).
- Sergio I. Minerbi, The Vatican and Zionism: Conflict in the Holy Land 1895-1925. Oxford, New York 1990
- Nah-Ost-Kommission der Deutschen Sektion von Pax Christi, Israel und Palästina. Position, Analysen und Hintergründe, 2. erweitere und aktualisierte Auflage, Bas Vilbel 1994
- Reiner Nieswandt, Abrahams umkämpftes Erbe. Eine kontextuelle Studie zum modernen Konflikt von Juden, Christen und Muslimen um Israel/Palästina, Stuttgart 1998 (Stuttgarter Biblische Beiträge 41).
- Augustus Richard Norton (Hrsg.), Civil Society in the Middle East, in: Social, Economic and Political Studies of the Middle East 50, Leiden 1995.
- Michael Prior, The Bible and Colonialism. A Moral Critique, Leiden 1997.
- Michael Prior, Zionism and the State of Israel. A Moral Inquiry, London 1999.
- Michael Prior, William Taylor (Hg.), Christians in the Holy Land, London 1994.
- Michael Prior, Western Scholarship and the History of Palestine, London 1998
- Hubert Prolongeau, Le curé de Nazareth: Emile Shoufani, Arabe israélien, homme de parole en Galilée, Paris 2000
- Mitri Raheb, Das reformatorische Erbe unter den Palästinensern. Zur Entstehung der evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien, Gütersloh 1990 (Die Lutherische Kirche. Geschichte und Gestalten 11).
- Mitri Raheb, Ich Christ und Palästinenser. Israel, seine Nachbarn und die Bibel, Gütersloh 1994.
- Mitri Raheb, Jericho zuerst , in: Dorothee Sölle (Hrsg.), Für Gerechtigkeit streiten. Theologie im Alltag einer bedrohten Welt (Festschrift für Luise Schottroff zum 60. Geburtstag), Gütersloh 1994, 174-179.
- Mitri Raheb, Olivenbäume der Hoffnung pflanzen. Der Friedensprozeß stellt die Christen Palästinas vor neue Aufgaben, in: Der Überblick, 4, 1995, 39-42.
- John Renard, Theological Perspectives on the Middle East, in: American-Arab Affairs 34, 1990, 56-63
- Mitri Raheb, Karl-Heinz Roneck, Der israelisch-palästinensische Konflikt und das Zeugnis der Christen, in: Erkunden und Versöhnen. Ökumenisches Arbeitsbuch Heinz Joachim Held zu Ehren, Frankfurt/M. 1993, 123-34.
- Audeh Rantisi, Ralph K. Beebe (Hg.), Blessed are the Peacemakers. A Palestinian Christian in the Occupied West Bank, Grand Rapids, Mich. 1990.
- John Renard, Theological Perspectives on the Middel East, in: American-Arab Affairs 34, 1990, 56-63.
- Matthias Ries, Die internationale Dimension des israelisch-palästinensischen Konfliktes, Trier 1996 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA, Sonderheft 4).
- L. Rokach, The Catholic Church and the Question of Palestine, London 1987.
- Samuel Rubenson, Church and State, Communion and Community: Some issues in the recent ecclesiastical history of Jerusalem, in: Heikki Palva, Knut S. Vikor (Hrsg.), The Middle East Unity and Diversity, Copenhagen 1993, 84-102
- Rosemary Radford Ruether, Herman J. Ruether, The Wrath of Jonah. The Crisis of Religious Nationalism in the Israeli-Palestinian Conflict, San Francisco 1989.
- Rosemary R. Ruether, Marc Ellis (Hrsg.), Beyond Occupation – American Jewish, Christian and Palestinan Voices for Peace, Boston 1990.
- Michel Sabbah, Les Chrétiens de Terre Sainte aujourd’hui et le dialogue des religions, in: Courrier Œcuménique 28, 1996, 50-57.
- Michel Sabbah, Statements on the Israeli/Palestinian Signing of the Declaration of Principles, in: MECC newsreport September/October 1993, 18-19.
- Bernard Sabella, The Diocese of the Latin Patriarchate. Introductory Study of the Social, Political, Economical and Religious Situation (West Bank and Gaza Strip, Jordan, Israel and Cyprus) , Jerusalem 1990.
- Bernard Sabella, Palestinian Christian emigration from the Holy Land, in: POC 41, 1991, 74-85
- Ursula Schneider, Land ist unser Leben. Galiläische Dörfer im Nahostkonflikt. Soziologie und Anthropologie, Frankfurt 1986.
- D. K. Shipler, Arab and Jews. Wounded Spirits in a Promised Land, London 1987.
- Martin Stöhr, Jüdisch-christlicher Dialog und palästinensische Theologie. Ein notwendiger Streit in der Ökumene, in: Ders., Dreinreden. Essays, Vorträge, Thesen, Meditationen. Hersausgegeben von Klaus Müller und Alfred Wittstock, Wuppertal 1997, 156-170.
- Harald Suermann, Neuere Veröffentlichungen zur palästinensischen Theologie, in: Missionswissenschaftliches Institut missio e.V. (Hrsg.), Jahrbuch für Kontextuelle Theologien 99, Frankfurt am Main 1999, 206-228.
- Harald Suermann, Palästinensische Theologie im Zeitalter der Intifada, in: Oriens Christianus 78, 1994, 104-122.
- Harald Suermann (Hrsg.), Zwischen Halbmond und Davidstern. Christliche Theologie in Palästina heute, Freiburg/B. 2001 (Theologie der Dritten Welt 28)
- Mohammed Taleb, Visages du sionisme chrétien: essai d’interprétation historique et théologique. Deuxième et dernière partie, in: Revue d’etudes Palestiniennes 22/ 74, 2000, 65-83
- John N. Tleel, Ecumenical Life in Jerusalem, Geneva 1991.
- Daphne Tsimhoni, Between the hammer and the anvil. The national dilemma of the Christian minority in Jerusalem and the West Bank, in: Orient 24, 1983, 637-644.
- Daphne Tshimhoni, The British mandate and the Arab Christians in Palestine 1920-1925, London 1976.
- Daphne Tshimhoni, The Greek Orthodox community in Jerusalem and the West Bank 1948-1978. A profile of a religious minority in a national state , in: Orient 23, 1982, 281-298. 24, 1983, 54-64.
- Hans Ucko, The Spiritual Significance of Jerusalem for Jews, Christians and Muslims. Geneve 1994.
- Graham Usher, Seeking sanctuary: the “Church” vs. “Mosque” dispute in Nazareth, in: Middle East Report 214/30, 2000, 2-4
- Jean-Pierre Valognes, Vie et mort des chrétiens d’Orient. Des origines à nos jours, Paris 1994.
- P.J. Vatikiotis, The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem beween (sic!) Hellenism and Arabism, in: Middle Eastern Studies 30, 1994, H. 2, 916-929.
- Donald E. Wagner, Anxious for Armageddon. A Call to Partnership for Middle Eastern and Western Christians, Scottdale 1995.
- Peter W. L. Walker, Jerusalem Past and Present in the Purposes of God, Carlisle ²1994.
- Ludwig Watzal, Frieden ohne Gerechtigkeit? Israel und die Menschenrechte der Palästinenser, Köln, Weimar, Wien 1994.
- Antonie Wessels, Arab and Christian? Christians in the Middle East. Kampen 1995.
- Petra Weyland, Geschichte einer Katastophe – Die palästinensischen Flüchtlinge seit 1948, Trier 2000 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA 45).
- Robert Wilken, The Land Called Holy. Palestine in Christian History and Thought, Yale University Press 1992.
- Roger Williamson (ed.), The Holy Land in the Monotheistic Faiths, Uppsala 1992.
- Rainer Zimmer-Winkel (Hg), Die Araber und die Shoa – Über die Schwierigkeit dieser Konjunktion. Bearbeitet von Götz Nordbruch, Trier 2000 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA 23).
- Rainer Zimmer-Winkel (Hg), Eine umstrittene Figur: Hadj Amin al-Husseini – Mufti von Jerusalem. Mit Beiträgen von G. Höpp, D. Rubinstein, S. Abu Dayyeh, W. D. Aries, Trier 1999 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA 32).
- Rainer Zimmer-Winkel, Dialog und Verständigungsbemühungen zwischen Palästinensern und Israelis in den 80er Jahren – Rolle und Bedeutung von Nichtregierungsorganisationen, Trier 1995 (Kleine Schriftenreihe des Kulturvereins AphorismA, Sonderheft 3)
- Al-Liqa´ Journal 1, 1992 ff
Zusammengestellt am 18.07.2001
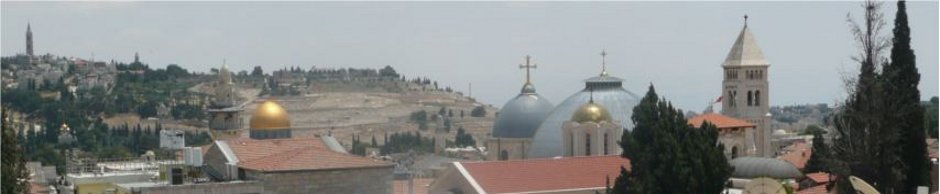
Neueste Kommentare